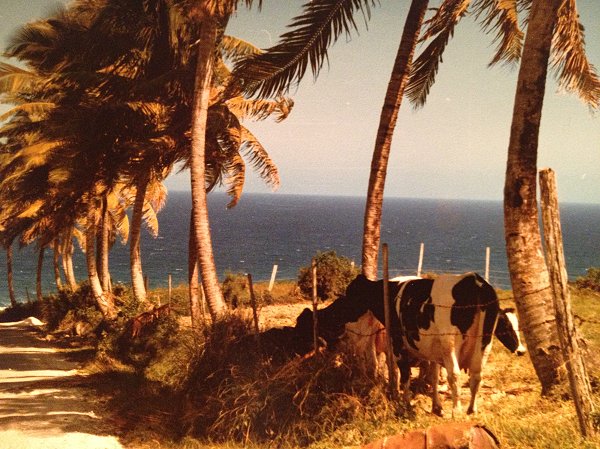Roman
Kapitel 1
An einem makellosen Tag im August fuhr Nadja Löffler mit dem Fahrrad bei Grün über die Stuttgarter Straße. Sie sah nicht nach links, vertraute auf die Ampel und bemerkte im Augenwinkel fast sofort einen dunklen Schatten. Erst undeutlich, dann aber massiv. Sie bremste scharf ab. Es knallte. Ja, es war ein Knall, es krachte nicht. War jetzt alles aus? Nach dem Knall hörte sie ein Pfeifen, wie von einem scharfen Wind, und ein Lastwagen rauschte an ihr vorbei.
So ein unverschämtes Glück! Es hatte sie nicht erwischt. Eine unendliche Schrecksekunde lang war ihr so, als wäre der Laster durch sie hindurchgefahren. Sie stand mitten auf der Fahrbahn und sah ihm mit weit aufgerissenen Augen nach, wie er die Straße Richtung Stuttgart hinaufbrauste.
Erst als ein Schwall von weiteren Fahrzeugen bedrohlich näherkam, sprang Frau Löffler auf den Sattel und trat hektisch in die Pedale. Sie schimpfte dabei laut auf sich selbst. Wie hatte sie nur so unvorsichtig sein können, sich auf die grüne Ampel zu verlassen! So leichtsinnig und faul. Sie hielt sich aber nicht allzu lange damit auf, sich über sich selbst zu ärgern, und radelte schon wieder in ihrem normalen, gemächlichen Tempo weiter. Seltsam, dass sie keinen Schrecken in den Knochen spürte, auch nicht zitterte. Ohne Schrecken davongekommen, sagte sie sich kurzerhand und bog von der Hauptverkehrsstraße in ihr Wohnviertel ein.
Dort drosselte sie ihr Tempo, musterte, wie so oft, die leerstehenden Einfamilienhäuser und Villen in der Königsberger Straße.
Viele Häuser waren unbewohnt, und es kamen immer neue dazu. Die Eigentümer starben weg und die Erben taten so, als wohnten sie dort, um die hohen Erbschaftssteuern nicht zahlen zu müssen. In Wahrheit blieben die Häuser leer. Oder die Erben hatten sich untereinander zerstritten und konnten die Häuser weder beziehen noch verkaufen.
Frau Löffler mochte die verwaisten Häuser, ihre Ausstrahlung. Sie schienen noch mit ihren ehemaligen Bewohnern verbunden zu sein. Die Häuser waren Inseln, auf denen das Leben stillstand. In ihnen schlummerten Möglichkeiten; alles konnte sich in ihnen künftig ereignen. Sie möblierte die Häuser in Gedanken mit Geschichten.
Links lag der unbewohnte Bungalow der Engers. Der Garten wurde nach wie vor gepflegt, obwohl die beiden schon vor zehn Jahren in einem exklusiven Altersheim gestorben waren. Eine gigantische Weißtanne überschattete den Rasen. Eiben drückten gegen die Fenster des Hauses, als wollten sie gewaltsam ins Innere dringen. Herr Enger war Vorstandsvorsitzender der örtlichen Kreissparkasse gewesen, Frau Enger Hausfrau. Ihre zwei Kinder wohnten noch in der Königsberger Straße, in den Häusern, die ihre Eltern ihnen nebenan gebaut hatten.
Am Ende der Straße standen zwei weitere Häuser leer. Bei dem einen hatte man nicht einmal Erben ermitteln können. Zuletzt hatte ein altes Paar darin gewohnt, dann nur noch die betagte Witwe. Schon vor ihrem Tod waren die Läden meist geschlossen gewesen, hatte das Haus unbewohnt ausgesehen. Womöglich hatte sie es alleine nicht mehr geschafft, die schweren Rollläden hochzuziehen.
Frau Löffler bog mit Schwung in die Elbinger Straße ein und hätte um Haaresbreite Nabucco, den fetten schwarzen Kater ihrer Nachbarin, gestreift. Das Tier war nicht einmal erschrocken, es trottete in aller Ruhe weiter. Sie korrigierte sich, es war nicht Nabucco, der war doch vor zwei Wochen unter ein Auto gekommen. Die Nachbarin hatte sich wohl schon Ersatz besorgt. Ähnelt das neue Haustier stark dem verstorbenen, kommt man leichter über den Verlust hinweg, behaupten manche. Es ist, als hätte der Tod nicht stattgefunden.
Als sie in die Einfahrt ihres Elternhauses einbog, musste sie schon wieder abrupt bremsen. Diesmal lief ihr eine alte Frau in die Quere. Auch die hatte sie erst im letzten Moment bemerkt. Frau Löffler entschuldigte sich bestürzt. Die Frau huschte geistesabwesend weiter, als hätte sie nichts bemerkt. Moment mal, sah sie nicht aus wie die alte Frau Meilner? Frau Meilner hatte im Block gegenüber gewohnt und war nun schon seit dreißig Jahren tot. Ihre Wohnung stand seitdem leer, und wie der Klempner erzählte, der dort neulich einen Siphon auswechseln musste, befand sich nach wie vor ihr gesamtes Mobiliar aus den Sechzigerjahren darin. Nichts war verändert worden, kein Gegenstand verrückt. Die Fensterscheiben überzog ein Grauschleier, die Vorhänge waren vergilbt, inzwischen lag alles unter einer zentimeterdicken Staubschicht. Frau Meilners Schwiegertochter plagte sich nicht mit Mietern herum, sondern wartete nur, bis die Immobilienpreise noch weiter stiegen.
Frau Löffler schaute der alten Frau verstört nach. Sie trug ein beiges Sommerkostüm mit knielangem, hinten geschlitztem Rock, das in die Sechzigerjahre gepasst hätte, und sah Frau Meilner wirklich zum Verwechseln ähnlich.
Frau Löffler stellte ihr Fahrrad in der Garage ab und schloss die Haustür auf. Auch in ihrem Elternhaus stand die untere Wohnung leer. Der Mieter, ein indischer Elektronikingenieur, war vor kurzem ausgezogen, weil er angeblich eine günstigere Wohnung gefunden hatte. Frau Löffler hatte den Verdacht, das war nicht der eigentliche Grund.
Was dann geschah, hätte bei ihr leicht einen Herzinfarkt verursachen können. Tat es aber nicht. Irgendwie hat sie es überlebt.
Die Wohnungstür im Erdgeschoss öffnete sich und ihre Großmutter trat ins Treppenhaus. Frau Löffler stand nur da, mit offenem Mund, starr vor Unglauben. Halluzinierte sie?
Die Frau auf der Straße hätte eine Person sein können, die der verstorbenen Frau Meilner verblüffend glich. Hier stand aber leibhaftig ihre Großmutter, Gertrud Herrmann, vor ihr, die mittlerweile fünfunddreißig Jahre tot war. Sie sah aus wie in ihren mittleren Siebzigern. Da war Frau Löffler ein Teenager gewesen … In ihr drehte sich alles. Terror, Wahnsinn, Unglauben und Sehnsucht verwirrten sich in ihrem Kopf. Sie hat ihre Großmutter innig geliebt, also wäre es eigentlich normal gewesen, sich in ihre Arme zu stürzen. Aber der Schock, eine Verstorbene vor sich zu haben, war zu groß.
„Du … du bist … doch tot?“, stammelte sie bloß.
Ihre Großmutter strahlte. Gleichzeitig kullerte eine Träne ihre Wange herab.
Frau Löffler konnte ihr nicht nur ansehen, wie sehr sie sich freute, ihre Enkelin wiederzusehen, sie spürte es auch ganz deutlich. Meine Güte, was für ein Irrsinn!
Die Großmutter ging gar nicht auf ihre Frage ein, sondern sprach sie an, als wäre es die normalste Sache der Welt, als hätten sie sich gestern erst gesehen. „Sei mir nicht böse, Nadja …“, sagte sie, „… aber ich möchte nicht rauf zur Rose.“
Rose, so hieß Frau Löfflers Mutter, die Tochter ihrer Großmutter.
„Ich war schon lange nicht mehr oben. Oben ist Roses Reich, hier unten ist meines.“ Das Lächeln verschwand aus ihrem Gesicht. „Die Rose war früher immer so aggressiv. Das hält mich ab.“
Himmel, was sollte das? Wie musste sie sich verhalten? Als Frau Löffler spontan nur weg hier dachte, sagte die Großmutter schnell und eindringlich: „Komm rein, mein Schatz, ich erkläre dir alles.“
Obwohl Frau Löffler eben noch fliehen wollte, betrat sie mit weichen Knien die großmütterliche Wohnung. Sie kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Alles war hier wie früher. Das gesamte Mobiliar ihrer Großmutter war wieder da, obwohl die Wohnung nach ihrem Tod komplett geräumt worden war. Es roch genau wie damals nach Kaffee und Kölnisch Wasser. Auf dem Esszimmertisch standen die Kaffeekanne unter der gehäkelten Wärmehaube, zwei Gedecke und ein selbstgebackener Marmorkuchen mit Schokoladenguss. Als hätte ihre Großmutter auf sie gewartet.
Frau Löffler wollte ihrer Großmutter nicht glauben, als die behauptete, dass sie, Nadja Löffler, tot wäre. Auch nicht, als die Großmutter aufrichtig weinte, weil der Tod ihre Enkelin mit ihren sechzig Jahren viel zu früh ereilt hätte. Frau Löffler fühlte sich sehr lebendig. Sie konnte sehen, hören, riechen, denken, sprechen, sich bewegen … Sie fühlte sich rundum normal und sogar besonders wohl, irgendwie leicht. Vielleicht war sie in einem Albtraum gefangen und wachte einfach nicht auf? Oder sie war plötzlich verrückt geworden und sah Dinge, die es nicht gab. Die es nicht geben durfte.
Frau Löffler sprang vom Kaffeetisch auf und eilte in den ersten Stock, hoch zu ihrer Mutter.
Oben war alles wie immer. Die Pflegerin bereitete in der Küche das Mittagessen vor. Die Mutter lag auf ihrem Fernsehsessel im Wohnzimmer und blätterte in einer Zeitung, die sie in ihrer geistigen Verwirrung schon lange nicht mehr lesen konnte.
Frau Löffler sprach sie an, aber die Mutter reagierte nicht. Sie streichelte ihre Hand. Die fühlte sich an wie immer: Weich, lauwarm, ein Geflecht von herausstehenden Venen auf dem Handrücken. Auch auf ihre Berührung reagierte die Mutter nicht. Frau Löffler versuchte, ihr die Zeitung aus der Hand zu nehmen. Es gelang ihr seltsamerweise nicht. Sie betastete das dünne Papier, die Zeitung reagierte aber nicht auf ihren Griff. Sie küsste ihre Mama auf die Wange, spürte ihre zarte Haut und feinste Härchen, küsste sie erneut. Die Mama rührte sich nicht. Sie sprach sie noch einmal an, benutzte die liebevollsten Koseworte, sagte schließlich laut und vorwurfsvoll Schnuckel. Ihre Mama schien es nicht zu hören.
Plötzlich bemerkte sie hinter sich die Pflegerin. Sie kam mit einem Glas Saft, stellte es auf das Seitentischchen neben Mamas Fernsehsessel. Frau Löffler rief: „Hallo Grazyna!“
Grazyna antwortete nicht, verzog keine Miene.
Sie lief einfach durch sie hindurch …
Kapitel 2
Frau Enger saß mit ihrem Gatten im Wohnzimmer und fing wieder mit dem leidigen Thema an: „Ich finde es nicht richtig, dass unsere Kinder ihr Leben weiterleben, ohne auch nur einmal an uns zu denken. Jette hat mich noch nie auf dem Friedhof besucht und Peter will sogar nächstes Jahr unser Grab auflösen. Nach kaum sieben Jahren.“
Herr Enger ruckte auf seinem Sessel hin und her, als säße er in glühenden Kohlen.
„Wir existieren für sie nicht mehr. Es ist sogar noch schlimmer. Es ist so, als hätten wir für sie nie existiert. Als hätte es uns gar nie gegeben. Nicht ein Wort über uns. Kein an uns verschwendeter Gedanke. Überhaupt nichts.“
„Peter und Jette haben Probleme. Probleme mit unseren Enkeln, Probleme mit ihren Partnern, Probleme, genug Geld zu verdienen. Sie müssen jeden Tag so viele Probleme lösen, da ist es kein Wunder, wenn sie ihre toten Eltern vergessen. Was hilft es denn, wenn sie an uns denken. Da werden sie nur traurig, und das wirft sie zurück.“
Frau Enger verzog ihr Gesicht. „Ich glaube nicht, dass sie traurig werden würden. Das Ärgerliche ist doch, sie waren nie traurig. Sie haben keine Minute um uns getrauert.“
„Aber auf der Beerdigung, da haben sie geweint.“
„Auf der Beerdigung, auf der Beerdigung … Die paar Krokodilstränen in der Öffentlichkeit. Am nächsten Tag hatten sie uns schon vergessen.“ Frau Enger sah ihren Gatten übertrieben weinerlich an. „Ist das denn normal, Reiner? Benehmen sich Kinder so? Gab es denn gar kein Band zwischen uns?“
Herr Enger zuckte nur mit den Schultern und dehnte die Mundwinkel.
„Wir haben alles für sie getan, Hiltrud. Wir haben ihnen sogar zwei Häuser gebaut!“
„Ich weiß, worauf du hinauswillst. Und ich bin strikt dagegen!“
Herr Enger seufzte laut. „Du musst die Kinder in Ruhe lassen. Du darfst sie nicht plagen. Ich bin sicher, wenn sie aus dem Gröbsten raus sind, werden sie sich an uns erinnern. Dann werden sie sogar die Trauer nachholen. Sie können es sich jetzt schlicht nicht leisten. Sie müssen nach vorne schauen. Es ist ihr Überlebensinstinkt, ihr Überlebensrecht.“
„Ach, papperlapapp. Nach dem Tod wird einem so manches klar. Da gewinnst du Einblicke, wie du sie zu Lebzeiten nie hattest. Unsere Kinder haben uns nie gemocht, obwohl wir alles für sie getan haben. So sieht die bittere Wahrheit aus. Dafür sollen sie bezahlen!“
Kapitel 3
Frau Löffler war am Boden zerstört. Niemand sah sie, niemand nahm sie wahr. Sie rief Grazyna laut ins Ohr. Grazyna hörte sie nicht. Sie kitzelte ihre Mama an den Zehen, dort war sie immer besonders empfindlich und schrie normalerweise wütend, sobald man sie berührte. Sie bewegte nicht einmal ihren Fuß und blieb stumm.
„Komisch, ich spür einen kühlen Luftzug“, sagte Grazyna nur und Frau Löfflers Mama zog sich die Sommerdecke bis hoch unters Kinn, anscheinend war ihr auch auf einmal kalt.
„Ihre Tochter ist noch nicht zurück. Wir warten mit dem Essen“, sagte Grazyna.
Bei dem Satz zogen sich Frau Löfflers Eingeweide zusammen. Sie setzte sich an den Wohnzimmertisch, legte die Stirn neben ihrem Gedeck auf die Tischplatte, die sich fest und holzig anfühlte, und heulte hemmungslos, mindestens eine Viertelstunde lang. War sie wirklich tot? Hatte sie der Lastwagen erwischt? Warum fühlte sie sich so gut? So normal? Nein, besser als normal? Was war nur mit ihr los?
Sie blickte zu ihrer Mutter hinüber, die ungerührt fernsah. Da saß ihre geliebte Mama nur wenige Meter von ihr entfernt und Frau Löffler konnte sie nicht erreichen. Sie konnte ihr nicht verständlich machen, dass es sie noch gab, dass sie unversehrt war. Noch nie in ihrem Leben hatte sie sich so hilflos gefühlt. Was sollte sie bloß tun?
Als sie die Verzweiflung völlig zu überwältigen drohte, nahm sie vor dem Fenster eine Bewegung wahr. Jetzt wurde es noch grotesker: Ihre Großmutter schwebte draußen vorbei und winkte. Sie bedeutete ihrer Enkelin, wieder zu ihr nach unten zu kommen. Irrsinnigerweise erinnerte Frau Löffler das an Renaissance- und Barockfresken, auf denen gerne mal nackte Personen durch die Gegend fliegen. Sie wischte ihre Tränen mit dem Handrücken ab. Wenigstens ihre Großmutter sah und hörte sie. Und sie liebte sie, was machte es da schon, dass sie tot war … Vielleicht konnte sie ihr in dieser verstörenden neuen Welt beistehen, konnte sie durch ihre Schrecken und Untiefen lotsen. Kaum dachte Frau Löffler an den vertrauten Kaffeetisch aus rötlichem Kirschholz in der Wohnung ihrer Großmutter, diesen Tisch, um den herum so viel Geselligkeit stattgefunden hatte, saß sie auch schon dort.
Es brauchte eine Zeitlang, bis sie es fassen konnte. Glücklicherweise saß ihre Großmutter ebenfalls dort und erklärte ihr, dass man sich hier fortbewegen konnte, indem man einfach intensiv an einen Ort dachte. Und nicht nur das, man konnte auch durch Wände hindurchgehen oder -fliegen. Die Wände existierten nur für die Lebenden, in deren dreidimensionalem Raum, zu dem sich noch eine weitere Dimension, die Zeit, gesellte. Die Toten hingegen, erklärte ihre Großmutter, existierten in einem höherdimensionalen Paralleluniversum. Dieses Paralleluniversum besetzte denselben Platz wie die Welt der Lebenden, es ging durch sie hindurch, jedoch ohne sie zu berühren. Die Lebenden spürten normalerweise nichts von der Welt der Toten. Es gab aber Wege für die Toten, auf die Lebenden einzuwirken. Die Toten konnten sich sogar sichtbar machen und den Lebenden erscheinen. Das sah dann aus wie ein Hologramm, ein dreidimensionales Bild, das in die Luft projiziert wird. Es sieht echt aus, hat aber keine Festigkeit; man kann hindurchgreifen, hindurchgehen.
Frau Löfflers Großmutter lachte: „Du kannst dir nicht vorstellen, welchen Schabernack manche Verstorbene mit ihren ehemaligen Angehörigen treiben, wenn sie ihnen in der Nacht als Geister erscheinen!“
Frau Löffler staunte, sie war entsetzt und sie war neugierig, sie war fassungslos, durcheinander und verängstigt, alles auf einmal.
Ihre Großmutter sah sie an und lächelte milde. „Sei ganz ruhig. Anfangs ist alles verwirrend und neu. Du gewöhnst dich aber rasch daran. Du hast hier ein blendendes Auffassungsvermögen. In der Welt der Toten fallen gewisse Beschränkungen weg, die uns in der Welt der Lebenden von allem möglichen Wissen und vielen Formen der Erfahrung abgeschnitten haben. Die Welt der Lebenden ist eine Welt von Gehandicapten.“
Frau Löffler murmelte flau: „Aha.“
„Ich erfuhr zum Beispiel von deinem Unfall im selben Moment, in dem er geschah, weil ich zu dir eine sehr enge Verbindung fühle. So konnte ich dir einigermaßen gefasst gegenübertreten. Und da ist noch viel mehr. Du kannst dich zum Beispiel frei durch die Welt der Lebenden bewegen, dort wie hier durch Dächer und Wände schweben, beobachten, was dort vor sich geht … Oder du kannst dein Alter frei wählen, zum Beispiel wie zwanzig aussehen … Und nicht nur das …“
Kapitel 4
Frau Enger hatte das Mittagessen aufgetragen. Eigentlich musste man im Jenseits nichts mehr essen, man konnte dort nicht verhungern und auch nicht verdursten. Schlaf brauchte man übrigens auch keinen. Manchen machte es aber Spaß, genauso weiterzuleben wie zuvor. Sie wollten riechen und schmecken, die Dinge genießen, die sie im Leben genossen hatten.
Herr Enger schöpfte sich Tomatensoße auf die dampfenden Spaghetti und sagte zu seiner Frau: „Es ist nicht normal, dass Eltern ihren Kindern das Leben schwer machen.“
„Wer sagt das?“, antwortete Frau Enger kühl.
„Manche Dinge sind einfach so. Sie haben sich in der Evolution bewährt.“
„Das ist mir egal.“ Frau Enger streute ihrem Gatten einen Löffel Parmesan über die Pasta.
„Wenn du so weitermachst, ziehen unsere Kinder noch aus ihren Häusern aus.“
„Na und?“, sagte Frau Enger nur.
Herr Enger schwieg eine Weile und kaute.
„Ein Umzug wird unsere Kinder schwer belasten. Sie haben schon genug um die Ohren. Vielleicht brechen sie zusammen oder ihre Ehen gehen auseinander … und sie verlieren ihre Stellungen …“
„Uns ging es doch nicht besser. Wir hatten auch dauernd Probleme.“
„Aber keine, die unsere toten Eltern mutwillig herbeiführten.“
Frau Enger musterte die ufoartige Designerlampe über dem Esstisch. „Woher willst du das wissen? Wo sind übrigens unsere toten Eltern? Die haben sich seit unserem Tod noch nie bei uns sehen lassen … Kein gutes Zeichen …“
Herr Enger atmete schwer. Er musste es loswerden: „Egal, wo sie jetzt sind, unsere Eltern hätten uns nie etwas zuleide getan! Und auch du würdest deinen Kindern nie schaden, wenn nicht dieser … dieser …“ Herr Enger wurde tiefrot von der Stirn bis zum unteren Halsansatz. Er konnte nicht mehr weitersprechen, hustete, spie Nudelstückchen samt Tomatensoße aus, würgte, bekam kaum mehr Luft.
Frau Enger blickte ihren Gatten ungerührt an, bis er sich wieder fing. „Ach, was du nur gegen Herrn Tober hast!“
Herr Enger bekam immer noch schwer Luft, keuchte: „Nur dieser Tober hat dich auf die Idee gebracht.“ Mehr brachte er nicht heraus. Ein Hustenanfall, der nicht mehr aufhören wollte, nahm ihm die Stimme.
Kapitel 5
Ihre Großmutter redete auf sie ein. Was sie ihr erklärte, klang bizarr. Frau Löffler konnte folgen, konnte sich mühelos konzentrieren, hatte aber so viele Fragen, dass sie die gar nicht alle zu stellen wagte. Um sich zu beruhigen, blickte sie sich im Wohnzimmer um, betrachtete das schwere Eichen-Buffet mit seinen Schnitzereien, das aus den Zwanzigerjahren stammte, und die grüne Samtpolstergarnitur mit dem hellbraun lackierten Nierentisch. Diese Möbel, die sie Jahrzehnte nicht mehr gesehen hatte, versetzten sie in eine weiche, melancholische Stimmung, die sie besänftigte.
„Wir erfahren viel nach unserem Tod …“, erklärte die Großmutter, „… alles aber wissen wir nicht.“ Sie sah flüchtig zu den Gummibäumen im Blumenfenster. „Viele der Gestorbenen leben weiter in ihren alten Häusern. Aber nicht alle.“
Frau Löffler sah ihre Großmutter aufmerksam an.
„Dein Opa lebt nicht bei mir. Und ich weiß nicht, wo er nach seinem Tod hin ist.“
Frau Löfflers Großvater war vor ihrer Geburt verstorben, sie hatte ihn nie kennengelernt. „Du hast mal gesagt, dass dir nach seinem Tod die Zeit mit ihm vorgekommen ist, als hätte sie gar nicht existiert. Als hättet ihr gar nie zusammengelebt.“
Die Großmutter wirkte nachdenklich und ging nicht auf die Bemerkung ihrer Enkelin ein. „Nicht alle, die hier gelebt haben, sind hiergeblieben. Wo die hin sind, wo dein Opa jetzt ist, da habe ich keine Ahnung.“
Ach, wenn nur nicht so viel unklar wäre. Frau Löffler fühlte sich einerseits überfordert, andererseits wollte sie unbedingt mehr erfahren.
In der Stimme der Großmutter schwang Verunsicherung mit, Frau Löffler spürte ein kleines Vibrieren, als die Großmutter sagte: „Du weißt ja, ich bin im Pflegeheim auf der Karlshöhe gestorben. Zum Glück war ich dort nur zwei Wochen nach meinem Schlaganfall. Als ich mich nach meinem Tod in dieser Welt hier wiederfand, spürte ich ein großes Verlangen, in meine Wohnung zurückzukehren. Ich glaube, vielen geht das so. Der erste Gedanke ist, ich will nach Hause. Also landete ich wieder in der Elbinger Straße. Deine Mutter hat, während ich noch im Pflegeheim lag, meine Wohnung ausgeräumt und die Möbel verkauft. Was nicht wegging, endete im Sperrmüll, bis auf meine Briefe und Fotos. Die Wohnung war also eigentlich leer, aber für mich war sie das nicht. Ich konnte wieder in meine Wohnung einziehen und alles war beim Alten, alle Möbel, mein ganzes Hab und Gut waren, für mich, noch da! Du siehst es ja selbst, sogar mein guter alter Kaffeetisch. Das war natürlich eine riesige Erleichterung. Das Sterben ist ja eine Riesenzumutung, es überfordert die meisten. Und dann kommt das Leben nach dem Tod. Das ist der zweite Schock. Natürlich bedeutet es Erlösung, Freude, aber es ist auch verstörend. Man ist erst mal auf sich gestellt und ist dann halt froh, wenn man in dieser neuen Welt doch noch die alte Welt wiederfindet, in der man vor dem Tod gelebt hat.“
Frau Löfflers Großmutter machte eine Pause und schenkte sich Kaffee nach. „Besonders hilfreich ist es, dass man von Anfang an andere Verstorbene trifft, die man vormals gut gekannt hat. Sie helfen einem, sie klären einen auf. Mit der Zeit lebt man sich ziemlich gut ein.“ Sie blickte durch ihr Blumenfenster auf die vorbeiziehenden Wolken. „Irgendwann fragt man sich aber, kann es das sein? Ist das der Sinn der Existenz, bis in alle Ewigkeit in unseren kleinen Wohnungen jeden Nachmittag am Kaffeetisch zu sitzen und selbstgemachte Erdbeermarmelade mit Hefekranz zu verputzen?“
Frau Löffler schluckte. Verzweiflung flog sie an. Es gab hier anscheinend auch negative Gefühle. Genau wie in der Welt der Lebenden.
Die Großmutter bemerkte prompt die Verunsicherung ihrer Enkelin. Sie strich ihr sanft über die Hand und blickte sie liebevoll an. „Wie gesagt, wir wissen nicht alles. Es scheint hier unterschiedliche Entwicklungsstufen zu geben, und dein Opa ist sicher schon weiter. Diejenigen, die in ihren alten Wohnungen und Häusern bleiben, hängen womöglich noch zu sehr am Materiellen. Irgendwann werden auch wir weiterziehen. Irgendwer wird uns hoffentlich mitnehmen.“ Sie seufzte. „Hier braucht man keinesfalls zu verzweifeln … Es ist schön hier.“ Sie zögerte, dann sah sie ihre Enkelin mit ernstem Blick an und sagte: „Aber irgendetwas stimmt hier dennoch nicht.“
„Etwas stimmt hier nicht?“, echote Frau Löffler und spürte eine Beklemmung in der Brust.
„Anfangs stellt man sich keine Fragen. Man lernt nur, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden. Man passt sich an. Man richtet sich ein. Ist das geschafft, kommen einem die ersten Dinge merkwürdig vor.“
Die Großmutter flüsterte. Warum? Wer konnte sie noch hören? Vor wem hatte sie Angst?
„Was heißt das?“, fragte Frau Löffler.
Die Großmutter sprach noch leiser, Frau Löffler musste sich über den Tisch beugen.
„Das heißt, es ist hier nicht so, wie es im Jenseits sein sollte.“
Frau Löffler nickte nur und blickte ihre Großmutter verdattert an, begierig, mehr zu erfahren.
Die Lippen ihrer Großmutter bewegten sich übertrieben. „Wenn du hierher gelangst, weißt du plötzlich sehr viel, verstehst sehr viel, bist hundertmal intelligenter als zu deinen Lebzeiten.“ Sie seufzte, als täte ihr etwas leid. „Aber die Toten sind nicht einen Deut vernünftiger.“
Was sollte das genau heißen, fragte sich Frau Löffler.
Das Flüstern der Großmutter wurde zu einem Zischen. „Die Toten sind genauso schlecht wie die Lebenden. Sie haben dieselben üblen Eigenschaften. Hass, Neid, Eifersucht, Gier und so weiter.“
Frau Löffler war verblüfft. War sie wirklich im Jenseits, dann hatte sie es sich so jedenfalls nicht vorgestellt.
„Zu einer höheren Intelligenz passt eine höhere Moral, sollte man meinen. Hier gibt es aber überall niederen Tratsch und Zank. Und seit Neuestem auch Böseres.“ Böseres betonte die Großmutter in einer Weise, dass Frau Löffler ein Prickeln auf den Unterarmen und ein Kitzeln an der vorderen Kopfhaut spürte.
„Es könnte hier so schön sein. Selbst wenn die Toten nicht perfekt sind. Richtig idyllisch … Wenn da nicht dieser Herr Tober wäre.“ Das Gesicht der Großmutter verzerrte sich beim Namen Tober zu einer Grimasse. Frau Löffler bekam augenblicklich Angst. So aufgebracht hatte sie ihre Großmutter nie gesehen.
„Wer ist das?“, fragte sie verwirrt.
„Er wohnt auf dem zugewachsenen Grundstück, hinter dem die Felder beginnen. Dort drinnen ist ein Holzhaus, das man von außen nicht sieht.“
Frau Löffler wusste, was sie meinte. Dort war ein verwilderter Fleck Land, der niemandem gehörte und nicht bewohnt war. Durch die Büsche konnte man eine Art Gartenhaus oder Geräteschuppen aus dunklem, morschem Holz erkennen. Merkwürdig, sie schaute sich doch sonst immer gerne im Vorbeifahren die verlassenen Häuser und Gärten an, aber dieses Grundstück hatte sie nie sonderlich beachtet. Die wenigen Male, die sie im Vorbeiradeln hingesehen hatte, war ihr das Grundstück unheimlich vorgekommen, wie es so vor sich hin verwilderte.
„Dieser Herr Tober ist schuld daran, dass die Stimmung in unserem Viertel ins Negative kippt. Ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn er nicht die toten Bewohner unseres Viertels aufstacheln würde, könnten wir hier trotz unserer noch bestehenden Macken in Frieden leben.“
„In dem verfallenen Holzschuppen wohnt jemand? Der war doch immer leer?“ Frau Löffler konnte sich das schlecht vorstellen.
Die Großmutter flüsterte nun nicht mehr, sie ereiferte sich. „Das Haus sieht nur von außen ein bisschen verwittert aus. Innen ist es vollständig renoviert.“
Alles hier war verwirrend. Vielleicht, ging es Frau Löffler durch den Kopf, befand sie sich doch nur in einem Traum?
Und wenn schon, sie fragte ihre Großmutter weiter aus, sie wollte über diese bizarre Welt unbedingt mehr erfahren: „Und was tut dieser Herr Tober genau?“
Die Großmutter rieb sich die Hände: „Er macht den Toten weis, wir hätten hier, in unserem Viertel, das Paradies, wenn wir erst einmal die Lebenden daraus vollständig vertrieben hätten.“
„Stören euch die Lebenden denn?“, wollte Frau Löffler wissen.
Die Großmutter senkte den Blick, als wäre ihr etwas peinlich. „Hier unten, in meiner ehemaligen Wohnung, bin ich momentan ungestört, sie steht ja leer. Wenn aber wieder eine lebende Person hier einzieht, bemerke ich diese Person von Zeit zu Zeit. Ich kann sie nicht permanent ausblenden.“ Sie sah ihre Enkelin an, als wollte sie sich entschuldigen. „Das stört. Es ist ein fremdes Element. Du bist nicht mehr vollständig zu Hause.“
„Ich verstehe“, sagte Frau Löffler, um ihre Großmutter zu beruhigen, und verstand dabei fast nichts. Wo war sie nur hingeraten?
Kapitel 6
„Liebstes Fräulein Kanter. Bald haben Sie es geschafft. Dann sind Sie endlich wieder Herrin in Ihrer eigenen Wohnung.“
Frau Kanter lächelte entzückt. Sie fühlte sich geschmeichelt.
Vor vielen Jahren war sie in der Toilette der Grundschule, an der sie als Sekretärin des Direktors gearbeitet hatte, einem tödlichen Herzinfarkt erlegen. Es hatte gedauert, bis sie begriff, dass es danach weiterging.
Entfernte Verwandte hatten für die ledig gebliebene Frau Kanter ein Urnenbegräbnis arrangiert. Frau Kanter hatte völlig verstört ihrer eigenen Beerdigung über der winzigen Trauergemeinde schwebend beigewohnt, dann hatte sie es nach Hause gezogen. Wo sollte sie sonst hin?
Als sie vor ihrer Wohnung in einem Sechziger-Jahre-Block in der Elbinger Straße gestanden hatte, hatte sie ihre ehemalige Nachbarin Frau Meilner, die vor ihr verstorben war, begrüßt und zu sich eingeladen.
Auch wenn Frau Meilner ihr vieles erklärt hatte, war Frau Kanter noch lange nach ihrem Tod verstört und unzufrieden gewesen. Sie hatte wie zuvor wenige Bekannte, lebte als alleinstehende Frau isoliert, und zu ihrer Unbill zogen irgendwann die Kaliphas, eine syrische Familie mit zwei Kindern, in ihre lauschige Dreizimmerwohnung ein.
Frau Kanter hatte es sich zwar gemütlich gemacht in ihrer früheren Wohnung; alles war erfreulicherweise genauso wie vor ihrem abrupten Tod. Die Kaliphas tauchten aber immer wieder bei ihr auf, durchquerten ihr Schlafzimmer, wenn sie sich gerade hinlegte, kamen ins Bad, wenn sie duschte. Und sie gingen einfach durch sie hindurch.
Es waren zwar immer nur Momente; die Kaliphas blitzten kurz auf und waren wieder fort. Diese Momente störten sie aber gewaltig. Frau Kanter fühlte sich so noch einsamer, fremd in ihren eigenen vier Wänden. Wie gut hatte es da Frau Meilner, deren Wohnung nach ihrem Tod nicht mehr vermietet worden war und seit vielen Jahren leer stand.
Bei ihrem täglichen Spaziergang durch die Felder, den sie schon zu Lebzeiten immer unternommen hatte, hatte Frau Kanter an einem Frühlingstag Herrn Tober kennengelernt. Etwas an ihm war ungemein gewinnend. Vielleicht hatte sie sofort Vertrauen gefasst, weil er ihrem Chef verblüffend ähnelte, dem Schuldirektor Dr. Bodenmüller, den sie ihr halbes Leben lang verehrt hatte. Herr Tober hatte nicht nur dessen große, schlanke Statur und die herben, asketischen Gesichtszüge. Tobers grauer, unauffällig gemusterter Anzug entsprach dazu exakt dem englischen Stil, den Dr. Bodenmüller für seine Garderobe gewählt hatte. Und so hatte sie die Einladung zum Tee in sein Holzhaus angenommen, ohne sich etwas Schlechtes dabei zu denken. Im Übrigen, was hätte passieren sollen, sie war ja schon tot.
Herr Tober machte Frau Kanter Komplimente. Er war dabei nie aufdringlich. Sie fühlte sich endlich wieder schön und jung, sie fühlte sich verstanden, in ihrem ganzen Sein gerechtfertigt. Herr Tober vermittelte ihr, dass sie etwas ganz Besonderes war. Er begriff genau, was ihr fehlte, worunter sie litt, und er wollte ihr helfen. Er weihte sie sogar in seinen geheimen Plan ein, aus dem Viertel ein Paradies zu machen.
Seither spielte sie nach Herrn Tobers Anleitungen den Kaliphas täglich, insbesondere nachts, Streiche. Ziel war es, die Kaliphas zum Ausziehen zu bewegen. Wenn Frau Kanter dann wieder ihr Terrain zurückerobert hätte und die anderen toten Einwohner des Viertels ebenfalls ihre Behausungen von den Lebenden befreit hätten, wenn das ganze Viertel schließlich wieder in den Händen der rechtmäßigen Besitzer wäre, dann begänne für alle das Paradies, hatte ihr Herr Tober versichert.
„Sie sehen heute wieder entzückend aus, liebes Fräulein“, flötete Tober und schenkte ihr einen Tee mit Rum ein.
Frau Kanter hatte ihre Jungmädchengestalt angenommen und blickte schwärmerisch drein.
„Bald, sehr bald, veranstalten wir etwas Besonderes in Ihrer Wohnung. Ihre lieben Nachbarn werden dabei sein und auch ich werde helfen. Wir wollen doch mal sehen, ob wir die Syrer nicht ein für alle Mal zum Auszug bewegen können.“
„Ach, Sie sind so wunderbar. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich stehe tief in Ihrer Schuld.“
Herr Tober lächelte nicht einmal, sah Fräulein Kanter nur ernst an.
Kapitel 7
Wie viele andere Verstorbene beschloss Frau Löffler, in ihrem letzten Zuhause zu bleiben. Vorerst zumindest, sagte sie sich, bis sie besser begriff, was hier eigentlich los war und was es sonst noch für Möglichkeiten für sie gab.
Sie wohnte im Dachstock über der Wohnung ihrer Mutter. Als die Mutter pflegebedürftig geworden war, war Frau Löffler zurück in ihr Elternhaus gezogen. Sie war ledig, hatte keine Kinder und konnte sich daher ganz der Mama widmen. Arbeiten konnte sie, als freie Autorin und Übersetzerin, überall. Die Möbel aus ihrer früheren Wohnung, die sie in den drei kleinen Dachzimmern nicht unterbringen konnte, lagerten in einem Container. Irgendwann, wenn das alles vorbei wäre, würde sie irgendwo anders ein neues Leben beginnen, hatte sie vorgehabt.
Inzwischen suchte Grazyna sie überall, telefonierte herum. Ohne Erfolg. Am nächsten Morgen kam die Polizei ins Haus und berichtete von Nadja Löfflers Unfall.
Frau Löffler fühlte sich jämmerlich; sie konnte ihrer Mutter nicht klarmachen, dass es ihr gutging. Sie schwebte durch die Zimmerdecke hinunter zu ihr und setzte sich neben sie, um wenigstens in ihrer Nähe zu sein. Nach einer Weile war es ihr, als könnte sie Geräusche im Kopf ihrer Mutter hören. Tatsächlich, zuerst ganz leise, es klang wie ein Flüstern, dann immer lauter, und langsam verstand sie Worte und sogar einzelne Sätze. Hier ein Gedanke, dort ein Gedanke, unverknüpft, ein Fetzen aus der Erinnerung, eine Beobachtung, die sich auf etwas im Zimmer bezog, alles ging durcheinander. Irgendwann begriff Frau Löffler, dass sie die Gedanken ihrer Mama lesen konnte, in Echtzeit. Konnte das sein? Es war überwältigend und verwirrend … Sie versuchte dasselbe mit Grazyna, blieb dicht neben ihr, während die ihren Verrichtungen nachging. Grazyna dachte an ihre Familie, an ihren nächsten Urlaub, aber auch an Nadja Löfflers schrecklichen Unfall, und es tat ihr sehr leid. Der Unfall verängstigte sie. Wie würde es jetzt mit Nadjas Mutter Rose Löffler weitergehen? Wer übernahm die Verantwortung? An wen sollte sich Grazyna wenden? Frau Löffler konnte Grazynas Gedankengängen gut folgen, sie waren kohärent. Und ihr wurde klar, dass ihre Mama im Kopf verwirrter war, als sie zu ihren Lebzeiten angenommen hatte. Die Mama hatte häufig bejahend gelächelt, wenn Frau Löffler sie etwas gefragt hatte. Sie hatte das als Einverständnis interpretiert. Dabei hatte die Mama sicher schon lange nichts mehr verstanden und das Lächeln war wohl so eine Art Überlebensreflex gewesen; einer freundlichen Person tut man weniger an. Was sie eigentlich hätte erschüttern sollen, der ungeheure Grad von Chaos im Kopf ihrer Mama, war für sie eine Erleichterung. Die Mama würde ihr Verschwinden womöglich gar nicht mehr begreifen und auch nicht darunter leiden. Sie wusste sicher nicht einmal mehr, was ein Unfall war. Sie lebte in einem weder glücklichen noch unglücklichen Nirwana. Mit fortschreitendem geistigem Verfall würde ihre geliebte Mama nur noch Körpergefühle empfinden, ein wenig Hunger, ein wenig Durst, Abneigung gegen Gurken, Hitze, Kälte, Schmerz. Ein gnädiges Schicksal gab es. Das wurde ihr klar. So litt man weniger, vegetierte dahin, glich einer Pflanze. Nur weniges, wie Licht, Wärme, ein Luftzug, eine Berührung, drang noch ins Unterbewusstsein und löste eine Reaktion aus, etwas Instinktives. Wenn sie später hinüberkam, zu ihrer Tochter, würde es für sie wie ein Erwachen aus einem jahrelangen Schlaf sein, behauptete Frau Löfflers Großmutter. Sie würde länger brauchen als die anderen, bis sie sich in der neuen Welt orientieren konnte. Das gehe allen Dementen so.
Kapitel 8
Herr Dr. Krepp hatte die Annäherungsversuche von Herrn Tober satt. Herr Tober war zwar einer der Wenigen, der ihn nach seinem Tod noch mit Dr. Krepp ansprach, was ihm überaus gefiel, hatte er seinen Titel doch hart erarbeiten müssen. Es war ihm aber auch klar, dass Tober ihm schmeichelte, um ihn für sich zu gewinnen. Tober wollte ihn bestechen, wollte dass er, Markus Krepp, bei seinem ruchlosen Plan mitmachte, das Viertel von den Lebenden zu säubern. Dass das Viertel, wenn nur noch Tote dort wohnten, zum Paradies werden würde, konnte sich Dr. Krepp nicht vorstellen. Überhaupt bezweifelte er, dass es hier ein Paradies geben könnte. Die Toten, die er von früher kannte, waren so launisch und unaufgeklärt wie zu ihren Lebzeiten; mit solchen Leuten war kein Himmelreich zu machen. Möglich, dass es sich an einem geheimen Ort befand, den er noch nicht kannte.
Dr. Krepp schnitt wütend die Hecke seines Einfamilienhauses. Er tat aus alter Gewohnheit, was er kurz vor seinem Tod, mit 92, noch mit letzter Kraft bewältigt hatte. Beim Schneiden der Hecke war er von der Leiter gefallen und in seine elektrische Schere gestürzt. Ein schauriges Blutbad. Ihm selbst hatte es allerdings nichts ausgemacht. Die Schere hatte ihm die Halsschlagader durchtrennt. Er war schneller tot gewesen, als seine Schmerzrezeptoren und sein Gehirn es mitbekommen konnten.
Herr Dr. Krepp war wütend. Er musste daran denken, wie die Kirche ihre Gläubigen zu Lebzeiten aufs Paradies vertröstete. Er hatte schon damals an kein Paradies geglaubt. Was sollte dort vonstattengehen? Ewiges Beten und Singen? War das erstrebenswert? Damit war es für ihn nicht getan. Er war mit einem ausufernden Wissensdurst geboren worden, er wollte die innersten Geheimnisse der Materie ergründen. Und jetzt, wo er im Jenseits angelangt war, regte sich wieder das Geschwätz vom Paradies, überdies in Gestalt dieses abgeschmackten Herrn Tober mit seinem Maßanzug, der wie der Kundenberater einer Kreissparkasse daherkam.
Während das Paradies, das die Kirche ihm verheißen hatte, bemerkenswert verschwommen blieb, war das Paradies von Herrn Tober vollkommen konkret in seiner Spießigkeit. Jeder Tote sollte wieder unumschränkter Herr seiner früheren vier Wände sein, das war alles. Es war so erbärmlich wenig, dass sich natürlich von vorneherein verbot, damit so etwas Optimales wie ein Paradies zu verbinden.
Herr Tober wollte ihm also etwas abscheulich Billiges andrehen, das ihn überhaupt nicht interessierte, und dafür sollte er in Zusammenarbeit mit seinen toten Nachbarn zuerst einmal die Lebenden aus den Häusern und Wohnungen der Elbinger Straße vertreiben und später dann diejenigen der Königsberger Straße, ferner die der Thorner Straße, Posener Straße und der Eugen-Nägele-Straße. In diesem Carré, vertraute ihm Tober an, gäbe es eine kritische Masse leerstehender Häuser, die von ihren verstorbenen Besitzern und Mietern bereits störungsfrei bewohnt würden, eine ideale Konstellation, die es ungemein erleichterte, die noch im Viertel Lebenden zu vertreiben.
Mit dem Gerede von der „kritischen Masse“ wollte er den Naturwissenschaftler in ihm ködern. Wer war überhaupt dieser Herr Tober? Was hatte er davon, wenn die Toten das Gebiet beherrschten? Herr Krepp war es gewohnt, analytisch vorzugehen, und das hieß, im Bereich menschlicher Beziehungen danach zu fragen, welche Interessen die Beteiligten haben. Das Interesse des Herrn Tober an einer lokalen Herrschaft der Toten war ihm schleierhaft. Etwas Gutes, so viel konnte man ungefähr ableiten, war damit jedenfalls nicht verbunden.
Kapitel 9
Die Sauers hatten sich immer als etwas Besseres gefühlt. Sie hatten auf ihre Nachbarn herabgesehen. Herr Sauer war Finanzvorstand derselben Kreissparkasse gewesen, die Herr Enger als Vorstandsvorsitzender präsidiert hatte. Auch auf die Engers sahen sie herab, insbesondere auf Frau Enger, die nicht einmal das Abitur geschafft hatte. Frau Sauer hatte ihre zwei Söhne nach humanistischen Grundsätzen erzogen, um sie bestmöglich auf ihre Karriere vorzubereiten, und literarische Nachmittage im Haus veranstaltet, was ihr mit ihrem Germanistikstudium nicht nur leichtfiel, sondern ihr auch ein wichtiges Anliegen war, weil man sich ihrer Ansicht nach durch literarische Bildung vom Rest der Menschheit abhob. Als die Sauers im Alter hilflos wurden, waren sie ins Heim gekommen: Ihre Söhne wohnten in Hamburg und München, weit weg.
Das Haus der Sauers war halb verfallen gewesen, als die Söhne es nach dem Tod ihrer Eltern an die Klingers verkauften, eine aufstrebende junge Familie mit zwei Söhnen. Die rissen das Haus großenteils ab und errichteten auf den Grundmauern ein völlig neues Gebäude.
Obwohl für die Sauers ihr Haus noch genauso aussah wie vor ihrem Tod, störte es sie, was die junge Familie damit veranstaltet hatte. Insbesondere Herr Sauer hegte einen tiefen Groll gegen die Klingers. Er war immer der Ansicht gewesen, sein Haus sei grundsolide gebaut. Auch nach seinem Tod wollte er nicht einsehen, dass er sein Haus in den letzten Jahrzehnten hatte verwahrlosen lassen. Er hatte jegliche Reparatur oder Erneuerung aufgeschoben, bis er starb. Hätte es sich um ein altes Haus mit gediegener Bausubstanz gehandelt, wäre etwas zu retten gewesen. Das Viertel bestand aber ausschließlich aus Häusern, die in den Sechzigerjahren gebaut worden waren, aus rasch und kostengünstig errichteten Nachkriegshäusern. Die konnte man nur noch abreißen, wenn man dreißig Jahre lang nicht renoviert hatte.
Herr Tober, dessen Holzhaus schräg gegenüber vom Haus der Sauers lag, stieß bei Herrn Sauer auf offene Ohren. Unbedingt und mit allen Mitteln wollte Herr Sauer die Eindringlinge, die sein Haus verunstaltet hatten, verjagen. Frau Sauer konnte die Wut ihres Mannes nicht vollständig nachvollziehen. Als Herr Tober ihr aber Nachmittage lang aus Thomas Bernhard vorlas und dabei Bernhard zum Verwechseln ähnlichsah, wollte auch sie ihren Teil dazu beitragen, die Klingers zu plagen, bis sie endlich auszogen.
Kapitel 10
Die ledig gebliebenen Schwestern Henne, die mit ihrer Mutter ein Reihenhaus bewohnt und ein Handarbeitsgeschäft betrieben hatten, litten genauso stark wie Herr Sauer unter den Lebenden. In ihrem Haus hatten sich nach ihrem Tod Griechen breitgemacht, wie sie es ausdrückten. Ein griechisches Rentnerehepaar, ehemals Gastarbeiter, war nach dem Tod der Henne-Schwestern in das Henne-Haus eingezogen. Die Griechen stellten alles dar, was die Hennes verachteten. Sie waren Ausländer und in ihren Augen dick, dumm, faul und auch noch ziemlich dunkelhäutig.
Die Hennes waren im Dritten Reich stramme BdM-Mädchen gewesen und die Mutter Henne hatte zu den glühenden Verehrerinnen Hitlers gehört. Die Schwestern hatten in ihren jüngeren Jahren jeden Tag Sport getrieben, sich dem Turnen und Schwimmen gewidmet, strikt Naturkost gegessen, ihre Tage mit eiserner Disziplin eingeteilt, sie waren um Punkt sechs aufgestanden und abends um Punkt zehn im Bett gewesen – und in den Ferien heimlich an einen FKK-Strand gegangen.
Die Sauers hatten sich zu Lebzeiten über die Hennes lustig gemacht. Die Mutter hatten sie als Despotin bezeichnet. Die jüngere Schwester hatte ihrer Ansicht nach Stroh im Kopf, die ältere war kaum klüger; daran hatte sich für die Sauers nach dem Tod nichts geändert. Was ihnen im Jenseits Rätsel aufgab, war die Mutter Henne. Sie wohnte nicht mehr mit ihren Töchtern zusammen. Und diese hatten noch kein Wort darüber verlauten lassen, warum das so war. Möglich, dass sie es selbst nicht wussten. Es gab noch etwas, das sich nach dem Tod geändert hatte. Zu Lebzeiten hätten Sauers und Hennes nie ein gemeinsames Projekt erwogen. Jetzt waren sie durch Herrn Tober und das gemeinsame Ziel, die Lebenden aus dem Viertel zu vertreiben, verbunden.
Da die Hennes auch nach ihrem Tod immer noch auf Männersuche waren, hatten sie die Einladung von Herrn Tober gierig angenommen, zumal Herr Tober groß, muskulös und blond war und die Hennes im Befehlston ansprach. Das imponierte beiden. „Ach, Herr Tober, Sie sind so gebieterisch“, begeisterte sich die eine. „Herr Tober, befehlen Sie, wir folgen Ihnen“, versprach die andere. Wie konnten sie auch nicht Herrn Tobers Anweisungen Folge leisten, wo er doch genau aussprach, was ihnen am Herzen lag. Das Viertel musste von den zugezogenen Fremdlingen gesäubert werden, sie waren minderwertig und drohten, die Volksdeutschen zu verdrängen, egal, ob diese nun lebten oder tot waren.
Kapitel 11
In den ersten Tagen nach ihrem Unfall musste sich Frau Löffler damit abfinden, ihre Mutter alleine gelassen zu haben. Gewissensbisse trieben sie um. Sie sagte sich, sie hätte den Unfall leicht vermeiden können. Jetzt war sie tot und ihre Mutter hatte niemanden mehr, kein direktes Familienmitglied, das sich um alles kümmerte, die Pflege organisierte, sie seelisch betreute, Anschaffungen tätigte, Reparaturen im Haus durchführte, die Rechnungen zahlte, mit den Krankenkassen verhandelte … Die Pflegerinnen waren zum Glück ziemlich selbständig, aber nicht selbständig genug. Unter normalen Umständen wäre Frau Löffler nahe am Nervenzusammenbruch gewesen. Jetzt, nach ihrem Tod, sah sie die Lage merkwürdigerweise von Tag zu Tag entspannter. Sie wusste, irgendwie würden sie sich durchwursteln, sowohl Grazyna als auch die zweite Pflegerin, Gisela, und ihre Mama würde bald erlöst. Nichts war mehr so schlimm, von ihrer jenseitigen Warte aus gesehen, nichts war ausweglos. Das Sterben war zwar manchmal mühsam, zog sich bei einigen hin, hinüber schafften es aber alle. Auch ihre Großmutter tröstete sie. Sie behauptete, niemand sei wirklich alleine beim Sterben. Selbst diejenigen starben nicht alleine, die einsam in ihren Wohnungen verendeten, ohne dass es jemand bemerkte, deren verweste Körper erst nach Tagen oder Wochen entdeckt wurden, weil ein Fäulnisgeruch nach außen drang. Die Verstorbenen, zu denen eine enge Bindung bestand, begleiteten sie hinüber. Dass ihre Mutter vielleicht ganz alleine sterben würde, ohne sie an ihrer Seite, die ihre Hand hielt, die sie umarmte und küsste, wäre für Frau Löffler das Schlimmste gewesen.
Allzu häufig kam sie in den ersten Tagen zum Glück nicht ins Grübeln. Sie hatte damit zu tun, die Toten im Viertel zu begrüßen, die sie zu ihren Lebzeiten gekannt hatte. Man traf sich früher oder später automatisch – auf der Straße, auf dem Feldweg, im Salonwald, in den Geschäften. Auch die Geschäfte waren dieselben geblieben und man konnte in ihnen genauso wie vor dem Tod einkaufen. Drinnen arbeiteten ausschließlich Tote, sie räumten die Regale ein und saßen an der Kasse. Bezahlen musste man allerdings nicht mit Geld, sondern nur mit einem Lächeln. Alle diese Begegnungen waren reichlich anstrengend.
Es war ein Glück, dass Frau Löffler die toten Nachbarn rasch erkannte. Viele sahen jünger aus, als sie sie von ihren letzten Begegnungen in der Welt der Lebenden in Erinnerung hatte. Aber sie wusste trotzdem sofort, wer sie waren. Man war hier scharfsichtig, erkannte in einem jüngeren Gesicht seine spätere Entwicklung. Frau Löffler wählte ebenfalls ein jüngeres Alter, verjüngte sich um dreißig Jahre. In ihren frühen Dreißigern hatte sie noch jung ausgesehen, sich jung gefühlt, gleichzeitig hatte sie das Nervenaufreibendste, den Berufseinstieg, hinter sich, erhielt endlich regelmäßig Übersetzungsaufträge von Verlagen, zumeist handelte es sich um Liebesromane, die sie aus dem Italienischen und Polnischen übertrug. Sie war zu der Zeit einigermaßen etabliert und hatte viele schlechte Erfahrungen und Enttäuschungen bereits hinter sich, nicht mehr vor sich; das Betteln um Aufträge, Zurückweisungen in der Liebe … Mit über dreißig kränkte sie nicht mehr alles tödlich. Sie fand sich damit ab, dass die Männer, die sie begeisterten, sich nicht für sie interessierten. Sie haderte nicht mehr damit, alleine geblieben zu sein. Lieber war sie alleine, als mit einem Mann zu leben, den sie nicht liebte.
Ihre Verjüngung machte keinerlei Schwierigkeiten. Es hatte ausgereicht, dass sie sich eindringlich ihr früheres, dreißigjähriges Selbst vorstellte.
Bei den Begegnungen mit verstorbenen Bekannten kamen intensive Gefühle hoch. Man hatte sich verloren geglaubt, aber nichts und niemand war verloren. Dass die Toten noch lebten, freute einen sogar bei Personen, die einem zu Lebzeiten nie sonderlich viel bedeutet hatten.
Die Hennes hatte sie nie gemocht, jetzt beurteilte Frau Löffler sie milder, wie so einige andere Verstorbene auch. Jedenfalls, bis sie von den Absichten der Schwestern erfuhr.
Usw.
Gefällt mir Wird geladen …










 Anna Zerbst, Mitte fünfzig, einsam und in prekären finanziellen Verhältnissen lebend, nimmt eine Stelle als Pflegekraft an. Ihr neuer Arbeitgeber ist ein ehemals einflussreicher und vermögender Mann mit einem äußerst problematischen Charakter. Sie bezieht ein Zimmer in der Villa Brunt und wird vom dortigen Hausmeisterehepaar in die tägliche Routine eingewiesen.
Anna Zerbst, Mitte fünfzig, einsam und in prekären finanziellen Verhältnissen lebend, nimmt eine Stelle als Pflegekraft an. Ihr neuer Arbeitgeber ist ein ehemals einflussreicher und vermögender Mann mit einem äußerst problematischen Charakter. Sie bezieht ein Zimmer in der Villa Brunt und wird vom dortigen Hausmeisterehepaar in die tägliche Routine eingewiesen.







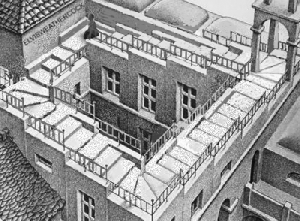






 Manchmal fallen einem alte Kinderbücher ein. Da entstehen die ersten großen Eindrücke. Aus den sechziger Jahren. Eine Bärenfamilie hat lange auf ihr erstes Auto gespart und kauft endlich den obligaten VW Käfer. Gleich auf der ersten Fahrt fahren sie im Übermut etwas zu schnell und bauen einen Totalunfall. Auf dem letzten Bild sieht man sie mit zerrissener Kleidung, verbundenen Köpfen, Armen und Beinen davonhumpeln. Die Bären taten mir unsäglich leid. Und ich fragte mich ängstlich: Ist das das Leben?
Manchmal fallen einem alte Kinderbücher ein. Da entstehen die ersten großen Eindrücke. Aus den sechziger Jahren. Eine Bärenfamilie hat lange auf ihr erstes Auto gespart und kauft endlich den obligaten VW Käfer. Gleich auf der ersten Fahrt fahren sie im Übermut etwas zu schnell und bauen einen Totalunfall. Auf dem letzten Bild sieht man sie mit zerrissener Kleidung, verbundenen Köpfen, Armen und Beinen davonhumpeln. Die Bären taten mir unsäglich leid. Und ich fragte mich ängstlich: Ist das das Leben?
 Eben entdecke ich, dass mein
Eben entdecke ich, dass mein