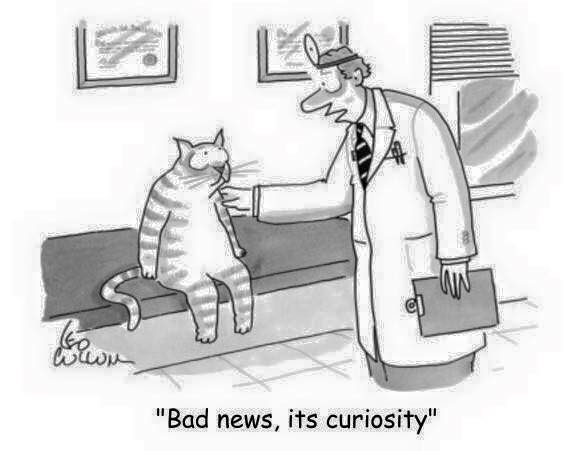„Luna Park 2“
„Jahrmarkt der Gier“
Was bisher geschah
Meine Geschichte, „Luna Park, Jahrmarkt des Grauens“, ist veröffentlicht worden. Tausende haben sie gelesen. Und viele konnten sie kaum glauben. Als Autor musste ich meinen Lesern eine Menge Fragen beantworten. Ich, Dugo, der kleine schüchterne Rothaarige. Etwa, wie meine Freunde und ich in einer Nebenwelt landen konnten, im „Luna Park“, diesem unheimlichen, gigantischen Vergnügungspark. Oder wer der König des „Luna Parks“ eigentlich war, der dort Tausende Mädchen und Jungs gefangen hielt.
Im Luna Park gab es ganze Häuser aus Schokolade, Achterbahnen im Dauerbetrieb, Wolkenkratzer aus Champagner, gigantische Kinos, Diskos und Videospielhallen, und, und, und. Keine Pflichten, keine Lasten, nirgendwo Erwachsene! Und alles war gratis. Man konnte schlemmen und sich vergnügen, soviel man wollte. Der Park versprach unendlichen Spaß.
Der Wahnsinn war nun: Wer nicht rund um die Uhr lachte, wurde vom König des „Luna Parks“ verhaftet. Und der König verwandelte die verhafteten Jungs und Mädchen in Comicfiguren. Die Comicfiguren landeten auf den Bildern seiner Gemäldesammlung und mussten dort ein trauriges Dasein in einer flachen Welt fristen. War man einmal in so einem Bild gefangen, konnte man sich nicht mehr bewegen. Man konnte aber noch denken und hören und sehen, was um einen vor sich ging. Es war schlichtweg grausam.
Ich habe mich über die vielen Fragen meiner Leser riesig gefreut. Ich konnte aber lange nicht alle Fragen beantworten. Und auch meine Freunde Zaza, Brauni und Camel, die mit mir im „Luna Park“ waren und mir beim Beantworten halfen, konnten es nicht. Für uns selbst war der „Luna Park“ ein riesiges Rätsel geblieben. Wie wir überhaupt in den „Luna Park“ geraten konnten, was dort vor sich ging, und was der König des „Luna Parks“ eigentlich bezweckte, wer er eigentlich war, blieb für uns ein Geheimnis.
Der „Luna Park“ war eine Art Hölle, aber wieder auch nicht. Uns ist dort letztlich nichts passiert. Es gab dort nicht einmal den Tod. Man blieb ewig jung. Aber es gab auch kein richtiges Leben. Wer will schon hundert Jahre Achterbahn fahren? Oder als Comicfigur in einem Bild ewig vier Wände anglotzen?
Allerdings haben wir im Park wiederum gelernt, dass wir uns und den anderen dort gestrandeten Jungs und Mädchen helfen mussten, um wieder nach Hause zu gelangen, in unsere normale Welt.
Das heißt, der Park war schrecklich und grausam, wir lernten dort aber, zusammenzuhalten, füreinander einzustehen.
Nebenwelten, Parallelwelten, kennt man aus der Physik. Wie ausgerechnet wir aber in eine hineingeraten konnten, da habe ich keine Ahnung. Haben wir irgendwo eine Raum-/Zeitbrücke benutzt, ohne es zu bemerken? Wer kann das schon wissen?
Da jedenfalls so viele von euch meine Geschichte verfolgt haben, und inzwischen meinen Freunden und mir noch viel mehr Ungeheuerliches passiert ist, Dinge die ihr im Traum nicht mal für möglich halten würdet, muss ich euch unbedingt die Fortsetzung berichten. Zaza, Brauni und Camel haben ihren Teil zur Geschichte beigetragen. Jeder hat mir haarklein seine Erlebnisse erzählt, und ich habe dann alles für euch zusammengeschrieben.
*
Letztes Jahr hatten unsere Eltern, wie ihr euch erinnert, uns wie Pakete in ein Feriencamp verschickt. Statt in diesem Camp, waren wir allerdings im Luna Park gelandet.
Als wir dann wieder aufgetaucht waren, waren unsere Eltern natürlich überglücklich gewesen. Sie hatten schon gedacht, wir seien entführt worden.
Dieses Glück hatte wochenlang angehalten. Doch dann war wieder alles zum Alten zurückgekehrt.
Meine Eltern, die reichen Zementfabrikanten und Workaholics, hatten mich wieder auf der Seite liegen lassen, als wäre ich gar nicht vorhanden.
Auch Zaza hatte bei ihren Eltern bald wieder keine Rolle mehr gespielt; die sind jetzt noch rund um die Uhr mit ihrer erfolglosen Arbeitssuche beschäftigt und ihren vielen Gelegenheitsjobs.
Nach der Sache mit dem Feriencamp war Camels alleinerziehende Mutter bald noch kontrollfreudiger geworden. Camel musste jede Minute seines Tags rechtfertigen, durfte keine Sekunde zu spät nach Hause komme. Er verlor seine Ruhe, seine Fähigkeit, einfach rigoros abzuschalten. Und in der Schule wurde er noch schlechter.
Am Schlimmsten hatte es Brauni erwischt. Nachdem sein Vater ihn ein paar Wochen lang fast liebevoll gehätschelt hatte, war er bald wieder heillos mit ihm überfordert. Brauni trug erneut schmuddelige Over-Size-Kleidung, wusch seine dichten braunen Haare nicht mehr, sodass sie fettig glänzten, und seine Fingernägel starrten erneut vor Schmutz. Er erpresste wieder Geld von seinen Klassenkameraden und verprügelte solche, die nicht zahlen wollten. Sein Vater hatte sich schließlich ans Jugendamt gewandt, und Brauni landete „vorübergehend“ in einer Pflegefamilie, bei einem Lehrerehepaar mit zwei Söhnen und einer Tochter.
Da Brauni ziemlich stämmig ist und auch gewaltbereit, wagten die Pflegeeltern keine größeren Übergriffe. Sie wagten nicht einmal, etwas gegen seine Verwahrlosung zu unternehmen. Brauni zog regelmäßig seine schmuddelige Kleidung aus der Waschmaschine, bevor sie dort jemand waschen konnte. Sie wiesen ihn nicht zurecht, kritisierten ihn nicht, sie machten es hinterhältiger. Beim gemeinsamen Abendessen redeten sie ausschließlich über sich selbst, über ihre Familie, mit ihren Kindern, Brauni wurde gar nicht beteiligt. Braunis Familie interessierte nicht. Es interessierte nicht, wer er war, was er dachte, was er am Tag gemacht hatte. Nichts an ihm interessierte hier jemanden.
Brauni war es eigentlich egal, die Leute interessierten ihn auch nicht, waren ihm völlig wurscht. Er wollte von ihnen auch gar nichts gefragt werden, möglichst nichts mit ihnen reden, von ihnen einfach in Ruhe gelassen werden. Ab und zu durchflog sein Gehirn dann aber doch der Gedanke, dass sie ihm damit klarmachen wollten, dass er Dreck für sie war.
Es gab dann noch andere Episoden, nach demselben Muster gestrickt. Eines Nachmittags wurde irgendetwas gefeiert, und alle bekamen Geschenke, außer Brauni. Erst ärgerte er sich, dann wurde es ihm auf einmal peinlich. Er lief rot an und zog sich in sein Zimmer zurück. Dort grübelte er dann doch länger unzufrieden nach, und das Wort „Demütigung“ fiel ihm ein. Demütigend für ihn war auch, wie sie reagierten, als er unglaublicherweise in einer Physikklausur ein „Gut“ nach Hause gebracht hatte. Die Tochter der Pflegeeltern war in derselben Klasse wie er und hatte dieselbe Physikarbeit geschrieben. Sie war mit einem „Befriedigend“ nach Hause gekommen. Der Vater lobte die Tochter überschwänglich, und zu Braunis Arbeit sagte er gar nichts. Am Abend dieses Tags unterhielten sich die Pflegeeltern nach dem Essen noch beim Aufräumen in der Küche. Gerade als Brauni an der Küchentür vorbeikam, um nach oben in sein Zimmer zu gehen, meinte er zu hören, wie die Frau zu ihrem Gatten sagte: „Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn.“ Das konnte nur auf seine Physikarbeit gemünzt sein.
Sie demütigten ihn, und ja, es kam ihm jetzt, sie verachteten ihn auch, hielten ihn für einen Nichtsnutz. Im Grunde erduldeten sie ihn, weil sie dafür bezahlt wurden.
Glücklicherweise hatte Brauni ein dickes Fell. Bald entschied er sich dazu, die Pflegefamilie einfach als Hotel anzusehen. Er lebte eben vorübergehend im Hotel, bis sein Vater ihn wieder zurückholte. Und schon ging ihm durch den Kopf, dass er den Leuten vielleicht ein paar Unannehmlichkeiten bereiten könnte, zum Beispiel die Badewanne überlaufen lassen, das Haus überschwemmen, so käme er vielleicht schneller wieder nach Hause. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht landete er dann sogar in einem Heim für Schwererziehbare. Also lieber im Hotelmodus bleiben.
Fortan beschloss er, die Pflegefamilie einfach ebenso zu ignorieren, wie sie ihn ignorierten. Die einzigen Worte, die er noch mit ihnen wechselte, waren „Guten Morgen“, wenn er sich an den Frühstückstisch setzte, und „Guten Abend“, wenn er aus der Schule nach Hause kam. Und er achtete darauf, dabei ein besonders blasiertes Gesicht zu machen.
Wie unser Abenteuer begann oder der Berliner Rummel
So war es uns also zu Hause ergangen. Nicht allzu erfreulich. Erfreulich war dagegen, dass wir dicke Freunde blieben seit unserem ersten gemeinsamen Abenteuer im „Luna Park“. Den Erwachsenen hatten wir nicht glaubhaft machen können, dass wir im „Luna Park“ gewesen waren, und so blieb der „Luna Park“ unser großes Geheimnis, das uns eng zusammenschweißte.
Der „Luna Park“ war unheimlich gewesen, furchteinflößend, und ebenso der König.
Irgendwann hatten wir sogar entdeckt, dass er gar kein menschliches Wesen war: Er hatte seinen Kopf abschrauben können! Was Zaza nicht daran gehindert hatte, ihn trotzdem noch verführerisch zu finden …
Und weil uns dieses unheimliche Gefühl, dieses Angstgefühl ziemlich lange nachhing, besuchten wir auch so schnell keinen Rummelplatz mehr.
Bis Brauni in der größten Frustration über seine Pflegefamilie eines Tags von sich gab: „Da war es ja noch besser im „Luna Park“.“ Und halb scherzhaft vorschlug: „Wir könnten eigentlich mal wieder auf nen Rummel, sozusagen aus alter Erinnerung.“
Camel, Zaza und ich waren zunächst nicht gerade begeistert, ließen uns dann aber doch überreden, auf das deutsch-französische Volksfest – „Volksfest“, was für ein blödes Wort – in Berlin Mitte am Kutschi zu gehen, um uns dort wenigstens die größte Achterbahn Europas und den Schwerelosigkeitssimulator anzusehen.
*
Am nächsten Tag trafen wir uns nachmittags bei Brauni. Sein Pflegevater öffnete die Haustür. Wir sagten knapp: „Wir sind mit Brauni verabredet“, und sahen den Mann möglichst blasiert an. Ich stellte mir dabei vor, er sei ein Hausdiener, und Brauni sei der Hausbesitzer. Brauni kam stürmisch die Treppen herunter, übersprang die letzten drei Stufen in einem Satz und setzte krachend unten auf, sodass der Hausdiener erschrocken herumwirbelte. Mit einem schroffen „Bis dann!“ schob sich Brauni an ihm vorbei.
Wir drehten uns auf dem Absatz um und verabschiedeten uns nicht. Die Tür fiel hinter uns etwas zu laut ins Schloss. Zugeknallt hatte der Hausdiener sie aber nicht.
Zum Rummelplatz war es von Braunis neuem „Zuhause“ eine Viertelstunde mit der S-Bahn, und seltsamerweise hatte uns so etwas wie freudige Nervosität gepackt. Wir fragten uns, würde es uns gruseln, wenn wir den Rummelplatz betraten? Wäre es ein Grusel, der eher aufregend wäre? Prickelnd? Wir waren neugierig, und hatten alle ein bisschen Angst, weshalb wir auf dem Weg dorthin besonders viele Witze machten.
*
Da lag nun die Hauptstraße des Rummels direkt vor uns. Von der gigantischen Achterbahn am anderen Ende tönten Geschrei und Gekreische herüber. Brauni, Camel und ich wollten jetzt nur noch eins: mit diesem Monstrum fahren. Zaza weniger, sie sah eher besorgt aus und kündigte schon an, dass sie unten auf uns warten würde.
Je näher wir kamen, desto mächtiger thronte die Bahn über allem anderen. Nur einmal hielt Zaza uns auf. Sie zeigte auf ein Spiegelkabinett. Dort wollte sie anschließend mit uns rein. Wir versprachen ihr, dass wir nach unserer Höllenfahrt dorthin zurückkehren würden.
Als wir unter der Bahn am Tickethäuschen standen, wurde mir fast schwindelig beim nach oben Sehen, so hoch und steil ging es hinauf. Die Wagen fuhren sadistisch langsam, mit einem ekelhaft kreischenden Geräusch nach oben, um dann quasi im freien Fall in die Tiefe zu stürzen, sich brutal in eine Kurve zu legen und mehrere Loopings in Hochgeschwindigkeit zu durchrasen. Ab und zu fuhr man auf dem Kopf. In den Kurven wurde man kräftig durchgeschüttelt. Unten kam man jeweils ziemlich unsanft auf. Man konnte in dem Ding wirklich den Verstand verlieren.
Zaza beobachtete, wie die Sicherheitsbügel von oben auf uns herabsanken und von einem Angestellten nochmals überprüft wurden. Sie fühlte sich ganz klar unbehaglich.
Obwohl wir eben noch gewitzelt hatten, wie lächerlich das Gekreische der anderen war, fingen auch wir an wie verrückt zu schreien, als wir in die erste Tiefe stürzten. Ich übertraf sogar noch Camel, der immer ängstlicher war als alle anderen, da ich den Eindruck hatte, mein Sicherheitsbügel halte mich nicht genügend nah am Sitz. Ich hob immer wieder Zentimeter von der Sitzfläche ab. Erst in der Kurve unten saß ich wieder fest im Sitz.
Auf dem letzten Streckenabschnitt machte ich die Augen zu. Ich hielt es einfach nicht mehr aus. Meine Güte, war ich erleichtert, als die Wagen ganz langsam die ebene Strecke zum Ausstieg entlangfuhren! Geradezu heuchlerisch langsam.
Ich stieg mit Schwabbelknien aus. Und selbst Brauni und Camel schwankten, als sie auf Zaza zugingen. Camel stolperte sogar eine Stufe hinab, fiel aber zum Glück nicht. Brauni fasste sich ans Kreuz. Seiner Ansicht nach waren die Wagen nicht genügend gefedert. Er hatte beim ersten Sturz in die Tiefe so etwas wie einen harten Schlag auf die Wirbelsäule gespürt.
Nach diesem Extremtrip wollten wir zuerst mal an einer Bude eine Cola trinken, um uns zu beruhigen, und waren dann ganz froh, Zazas Vorschlag mit dem Spiegelkabinett aufnehmen zu können. Das war eine ruhige Sache und würde auch nicht allzu verwirrend, solange wir dort drinnen zusammenblieben.
Das Päuschen hatte gut getan. Wir betraten das Spiegelkabinett locker und entspannt. Zaza ging vor uns her. Sie sollte schließlich die Freude haben, den richtigen Weg zu finden. Eine Weile lang bewegten wir uns im Kreis und kamen einfach nicht weiter. Dann musste Brauni irgendwo abgebogen sein und war von uns plötzlich durch Glaswände getrennt. Als er versuchte, wieder zu uns zu stoßen, lief er mit dem Kopf gegen eine Glaswand. Die Glaswände waren so makellos geputzt und reflektierten so wenig, dass man sie kaum sah. Brauni fluchte laut und fasste sich an die Nase. Fortan tastete er mit Händen um sich. Wir kamen nicht mehr zusammen. Brauni geriet immer mehr nach links, in Richtung Ausgang, und wir kamen aus der rechten Ecke nicht heraus.
Irgendwann führte uns ein Weg rechts außen ins Zentrum des Kabinetts. Dort war ein großer Raum mit roten Samtsofas und Spiegeln, in denen man sich verzerrt sehen konnte. Und zu unserer Freude war auch Brauni bereits dort angekommen und starrte in einen Spiegel, der ihn um Meter in die Länge zog.
Wir hatten ziemlich viel Zeit gebraucht, bis wir hier gelandet waren, und mir ging das Herumgeirre langsam auf die Nerven. Wie lange würde es noch dauern, bis wir hier wieder rauskämen, fragte ich mich. Und wenn wir den Weg nicht fänden, würden sie draußen darauf aufmerksam und kämen herein, um uns rauszuführen?
Brauni unterbrach meine Gedanken, indem er plötzlich schrie: „Habt ihr den Typen dort gesehen?“
Wir folgten Braunis Blick, sahen aber niemanden.
„Da ging ein Mann mit Frack und Zylinder vorbei, der sah aus wie der König des „Luna Parks“!“
„Du spinnst“, warf Camel ein.
„Du willst uns bloß Angst machen“, rief ich.
Dass Brauni nicht gelogen hatte, wurde wenig später klar. Zazas Gesicht lief rot an. Brauni, Camel und ich gafften mit offenen Mündern. Es blieb uns nicht mal Zeit, unserem Schrecken mit Worten Ausdruck zu geben. Der Mann in Zylinder und Frack betrat schon den Spiegelsalon. Wir starrten ihm wie gelähmt entgegen.
Von Zaza hörte man zuerst einen Laut: ein leises „Ha!“
Der Mann war geschminkt wie ein Clown, viel kleiner als der König des „Luna Parks“, und fragte uns höflich, ob er uns heraushelfen solle, oder ob wir lieber selber den Weg zum Ausgang finden wollten.
Wir waren doch alle stark erschrocken, auch wenn die Situation jetzt etwas Lächerliches hatte. Und so wollten wir uns nun gerne den Weg nach draußen zeigen lassen. Keiner von uns hatte Lust, noch länger hier drinnen herumzuirren.
Draußen setzten wir uns erstmal auf eine Bank.
„Wer hat Angst gehabt?“, fragte ich.
„Alle haben Angst gehabt, sogar ich“, gab Brauni offen zu.
„Ich war zumindest riesig überrascht“, bemerkte Camel.
„Und dann der Clown …“ Zaza klang quasi enttäuscht.
Wir blieben noch eine Weile sitzen – eine milde Julisonne schien auf uns herab – und entspannten uns. Brauni besorgte Popcorn und noch mehr Cola – mit dem erpressten Geld seiner Mitschüler.
„Alles in Ordnung?“, fragte schließlich Zaza.
Es war wieder alles in Ordnung. Wir fühlten uns seltsam gut. Es war anscheinend kein zu großer Schock gewesen. Deshalb beschlossen wir, uns noch weitere Attraktionen anzusehen.
Wir schlenderten durch die Straßen, blieben vor Riesenschiffschaukeln und Berg- und Talbahnen stehen. Schauten uns den Schwerelosigkeitssimulator an. Fuhren schließlich alle vier mit einem altmodischen Round-up, weil der Schwerelosigkeitssimulator zu teuer war.
Zaza wurde vom Round-up schwindelig. Sie wollte als Nächstes etwas Langsameres ausprobieren.
„Da kommt höchstens die Geisterbahn dort drüben infrage“, schlug Brauni vor.
Die Geisterbahn
„Welche Geisterbahn? Ich seh keine.“ Mein Blick folgte Braunis Zeigefinger.
„Ach die“, sagte Camel, reckte den Hals und kniff die Augen zusammen. „Ganz dort hinten. Langsam denk ich, ich brauch ne Brille.“
Zaza bemerkte: „Seltsam, um die Geisterbahn wabert eine Art Nebel.“
„Rauch von den Grillbuden“, erklärte Brauni ungerührt.
Ich sah die Bahn immer noch nicht und wollte den andern schon vorwerfen, dass sie mich veräppelten. Dann tauchte sie hinter einer Rauchschwade auf. Die Grillbuden waren wirklich ekelhafte Luftverschmutzer.
Wir schlenderten hinüber und besahen uns die Geisterbahn aus der Nähe. Hexen, Kobolde, Zwerge, Kröten, Feuer speiende Drachen waren über die Front gemalt. In so poppigen Farben, dass sie eher lustig als gruselig wirkten.
„Ich glaub, das ist ne Geisterbahn für Babys“, murrte Camel. „Dafür geb ich mein Geld nicht aus. Ich hab sowieso nur noch ein paar Euro.“
„Camel hat recht, Kleinkinderkram“, bestätigte Brauni. „Womöglich passen wir nicht mal in die Wagen.“
Bei Braunis Körperumfang konnte das hinkommen, musste ich denken.
„Hier ist auch nichts los, hier fährt gar keiner. Es lohnt sich ganz klar nicht“, stellte Camel fest.
„Zaza, wenn du unbedingt fahren willst, begleite ich dich“, bot ich sofort an. „Akzeptiert! Für mich tut’s ein harmloser Grusel.“
Zaza und ich, wir stiegen also ein, nachdem wir unsere Tickets gelöst hatten. Wir waren die Einzigen. Niemand wollte Geisterbahn fahren. Wir hatten die ganze Bahn für uns. Ich blickte vom Wagen nochmals auf die Straße. Die Leute gingen an der Geisterbahn vorbei, sahen nicht mal hin.
Unser Wagen setzte sich ganz langsam in Bewegung, blieb stehen, machte einen Ruck, blieb stehen, machte wieder einen Ruck, und glitt dann plötzlich überschnell durch eine Klapptür, ein Froschmaul, in völlige Finsternis.
Zaza klammerte sich spontan an mir fest. Was mich sehr freute.
„Du, hier ist die Beleuchtung ausgefallen.“
„Merkwürdig“, gab ich nur zurück und fürchtete mich auch ein bisschen.
Der Wagen glitt auf Schienen dahin. Man hatte kein Gefühl dafür, ob er langsam oder schnell fuhr. Etwas Weiches, wahrscheinlich von der Decke hängende Stofffransen, wischte über unsere Gesichter. Wir schrien unisono. Das war keine harmlose Babybahn, das war Folter. Man war in vollkommener Dunkelheit und wartete nur darauf, was als Nächstes unvorhergesehen passieren würde. Und wir konnten uns nicht mehr gegen den Gedanken wehren, dass es auch etwas Schlimmes sein konnte.
*
Camel und Brauni standen sich derweil draußen die Beine in den Bauch. Die Fahrt dauerte schon zehn Minuten, viel zu lange für den lächerlichen Betrag von zwei Euro pro Person.
Brauni fragte den Mann am Ticketschalter: „Sie, äh, unsere Freunde sind schon seit zehn Minuten da drin. Wann kommen die denn raus? Ist das normal?“
Der Ticketverkäufer blickte Brauni und Camel erstaunt an. „Das kann nicht sein.“ In seiner Kabine war ein Schaltpult, das er jetzt kontrollierte.
Brauni stellte sich auf Zehenspitzen, beugte sich vor, um ins Häuschen zu sehen, und sah ein Lämpchen rot blinken.
„Hmmm. Da stimmt was nicht“, gab der Ticketverkäufer schließlich zu. „Der Alarm leuchtet. Der Strom drinnen ist ausgefallen.“
„Dann stecken Zaza und Dugo fest?“ Brauni war etwas fassungslos.
„Womöglich im Dunkeln.“ Camel versuchte seiner Stimme einen tiefen, unheimlichen Ton zu verleihen.
„Moment!“ Der Ticketverkäufer verließ sein Häuschen, stieg auf die Schienen vor den ersten Wagen und versuchte das Froschmaul zu öffnen. Er drückte sich mit seinem ganzen Gewicht dagegen. Die Klapptür ging aber nicht auf. Er fluchte, kam zurück und holte aus dem Häuschen eine Art Brechstange. Dann hebelte er an der Tür herum. Mit aller Kraft. Sie öffnete sich nicht. Er stieg wieder von der Bahn herunter und rief: „Ich muss den Pannendienst anrufen.“ Er tippte auf seinem Handy herum.
Brauni und Camel stiegen nun auch zum Froschmaul hinauf und rüttelten an ihm. Es war nichts zu machen.
„Ich dachte, die Klapptüren wären aus Pappe oder höchstens aus Sperrholz. Das Ding hier wirkt aber wie ne Safetür. Wie aus Eisen.“ Brauni war fix und fertig.
„Krass! Lass uns die andre Tür probieren, aus der sie wieder rauskommen müssen“, schlug Camel vor.
Die Tür mit dem Drachenmaul war ebenso solide verschlossen.
Brauni trat wütend gegen die Wand neben dem Drachenmaul und schrie gleich laut auf: „Hart wie Stein!“
„Versteh ich nicht“, erwiderte Camel. „Das Zeug ist doch meist aus Leichtbauteilen zusammengesetzt, damit man es schnell auf- und wieder abbauen kann?“
Brauni zog seinen Schuh aus und rieb sich mit schmerzverzerrtem Gesicht lange die Zehen. Schließlich schlug er vor: „Lass uns mal um das Ding rumgehen.“
*
Drinnen herrschte nach wie vor pure Finsternis. Zaza und ich hatten das Gefühl, der Wagen bewege sich auf den Schienen immer weiter fort.
„Wie lange soll das so weitergehen?“, fragte Zaza bang.
Ich hatte selbst gehörig Angst, durfte mir aber nichts anmerken lassen, musste Zaza beruhigen: „Es muss so sein: Die Bahn hat eine Panne. Die Beleuchtung ist ausgefallen, und die Wagen bewegen sich immerfort im Kreis.“
„Es fühlt sich aber nicht an wie ne Kreisfahrt. Ich hab den Eindruck, wir fahren immer weiter geradeaus.“ Zaza hatte nur noch ein Stimmchen.
„Das kann doch gar nicht sein, die Geisterbahn ist höchstens zwanzig Meter lang und zehn breit“, versuchte ich ihr unaufgeregt klarzumachen. Meine Stimme zitterte aber verdächtig. Auch ich hatte das Gefühl, wir führen geradeaus und hätten schon eine ziemliche Strecke zurückgelegt. „Es ist alles wegen der Dunkelheit. Die Dunkelheit verwirrt uns, sie täuscht uns vor, wir bewegten uns auf einer geraden Linie.“
„Kann sein“, piepste Zaza wenig überzeugt und klammerte sich noch fester an meinen Arm.
„Zeit, dass wir um Hilfe rufen, Zaza. Mit der Bahn stimmt definitiv was nicht“, schlug ich endlich vor.
Es war wenig sinnvoll, die Situation noch länger schönzureden. Aus Leibeskräften riefen wir nun um Hilfe.
*
Brauni und Camel bogen draußen um die Ecke der Geisterbahn, um sich die Hinterseite anzusehen.
„Vielleicht kommen wir dort irgendwo rein.“ Brauni pochte mit der Faust gegen die Hinterwand. „Nicht zu fassen, wie aus Stein!“
Camel spitzte die Ohren. „Horch mal … schscht!“
Beide horchten mit angehaltenem Atem.
„Ja, ich hör’s auch. Hilferufe. Ganz leise.“
„Klingt wie von ungeheuer weit weg.“
„Es sind Zaza und Dugo!“
„Verdammt, was ist dort drinnen los?“
*
Ich wünschte, ich hätte eine der Pillen gehabt, die meine Eltern sich immer unter die Zunge legen, wenn sie nervös sind. Sie lösen sich in Nullkommanichts im Mund auf, und man wird rasch gleichgültig.
Auf unsere wiederholten Schreie erfolgte keine Reaktion. Wir schrien wirklich aus voller Kehle, und Zaza kreischte noch dazu in einem so hohen, durchdringenden Ton, dass uns eigentlich jeder hören musste. Draußen waren doch noch der Ticketverkäufer, Brauni und Camel und zahlreiche Rummelbesucher. Vielleicht hatten sich Brauni und Camel bei dem langen Warten gelangweilt und waren woanders hingegangen. Und der Ticketverkäufer schlief, weil keine Kundschaft da war. Und die anderen Rummelbesucher waren zu weit weg, um uns zu hören.
Zaza weinte ganz leise an meiner Schulter. „Ich möchte hier raus.“
Ich fühlte mich hilflos, ohnmächtig. Wie konnte ich Zaza trösten? Ich war selbst mit den Nerven fertig.
Da nahm ich vor uns, ziemlich weit weg, einen winzigen Lichtschimmer wahr. Ich wies Zaza sofort darauf hin.
„Was ist das? Geht’s dort raus?“, fragte sie mich, als ob ich alles wissen müsste.
Es machte den Eindruck, als ob wir auf den hellen Schimmer zufuhren.
„Was ich nicht verstehe: Das Licht scheint so verdammt weit weg. Das kann doch gar nicht sein. Hier gibt’s doch nicht solche Strecken.“
„Vielleicht ne optische Täuschung. Vielleicht nur ein winziges Loch in ner Außenwand“, bemerkte Zaza kleinlaut.
Auf einmal beschleunigte der Wagen spürbar. Wir glitten geräuschvoll über die Schienen. Fahrtwind blies uns ins Gesicht, und Zaza und ich hielten uns eng umklammert. Wer wen zuerst umarmt hatte, wusste ich später nicht mehr. Ich presste aus Angst die Augen zu, öffnete sie dann aber wieder. Es sah so aus, als glitten wir durch einen dunklen Tunnel, an dessen Ende ein Ausgang ins Licht führte.
*
Während Brauni noch die Hinterseite der Bahn untersuchte und immer wieder laut nach Zaza und mir rief, sah sich Camel das hintere Umfeld der Bahn an.
„Keine Möglichkeit, hier irgendwo reinzukommen“, murrte Brauni unzufrieden und erschrak, als Camel ihn plötzlich hart an der Schulter packte. Brauni wirbelte herum. „Spinnst du? Was ist los?“
Camel brachte kein Wort heraus und wies nur mit ausgestrecktem Arm auf die riesigen Wiesen hinter der Geisterbahn.
„Verdammt!“ Brauni riss die Augen auf. „Da stimmt was überhaupt nicht. Wir sind doch mitten in der Stadt. So riesige Wiesen kann’s hier gar nicht geben. Und auch die Berge dort hinten stimmen nicht.“
Brauni bekam schwache Knie und setzte sich auf den Boden. Camel saß bereits, mit dem Rücken an die Geisterbahn gelehnt. Beide starrten in die weite Landschaft, auf Wiesen, Berge, einen See, und atmeten erst mal tief ein und aus, um sich zu beruhigen.
Dann sprang Brauni unvermittelt auf. „Los, um die Geisterbahn rum, wieder nach vorn! Dort ist vielleicht noch alles normal, dort sind wir sicher noch auf dem Rummel am Kutschi, in unserem Berlin.“
*
Das Licht am Ende des Tunnels blendete so stark, dass ich meine Augen wieder schloss. Zaza hatte ihr Gesicht an meiner Schulter geborgen, sah nichts und wollte gar nichts sehen. Durch meine geschlossenen Augenlider nahm ich die Helligkeit rötlich wahr, und auf meiner Haut spürte ich so etwas wie Sonnenwärme. Es fühlte sich an, als glitten wir immer noch weiter auf Schienen. Ich war verwirrt, wusste nicht, was ich von all dem halten sollte, öffnete schließlich meine Augen ganz zögerlich, voller Angst, hatte bereits den Verdacht, dass wir nicht ankommen würden, wo wir eingestiegen waren. Tatsächlich, jetzt sah ich etwas vor mir, das nichts mit der Umgebung der Geisterbahn auf dem Rummelplatz zu tun hatte, aber auch gar nichts.
*
Brauni lief im Eilschritt um die Bahn herum. Camel sprang hastig hinterher. Vorne angekommen, war alles – alle Buden, alle Karussells, jegliche Rummelattraktion – verschwunden. Und es waren auch keine Leute mehr da. Die Geisterbahn stand ganz alleine mitten auf einer Wiese. Brauni lief aus Verzweiflung zum Tickethäuschen, in der Hoffnung, wenigstens der Ticketverkäufer wäre noch da. Das Häuschen war leer. Auf dem Schaltbrett blinkte weiterhin die Alarmlampe rot. Es war gespenstisch.
*
Wir waren endlich aus der Geisterbahn herausgefahren. Vor mir befanden sich die anderen Wagen und der Eingang mit dem Froschmaul. Von der Bahn grinsten die Zwerge, Hexen, Kobolde, Kröten und Feuer speienden Drachen auf mich herab. Aber sonst sah alles völlig anders aus. Da war nicht mehr die Straße mit den Buden, Zelten, Berg- und Talbahnen und Spielhöllen. Ich starrte auf eine Wiese! Auf die Wiese schien eine senkrecht am Zenit stehende Mittagssonne, und in der Ferne verschwammen Berge im blauen Dunst. Der Rummel war einfach weg. Und die Zeit musste zurückgesprungen sein. Zaza presste ihr Gesicht immer noch an meine Brust. „Ist es schlimm?“, fragte sie weinerlich.
„Wir sind auf einer Wiese“, antwortete ich schwach. „Du kannst die Augen aufmachen.“ Ich versuchte, so harmlos wie möglich zu klingen.
Zaza sah sich jetzt ebenfalls um, mit weit aufgesperrten Augen. „Das kann nicht sein!“ Sie musste geweint haben, ihr Lidschatten war verlaufen, und die ganze Schminke war jetzt auf meinem T-Shirt.
Ich versuchte, aus dem Wagen zu steigen, was mir schwerfiel mit meinen Gummiknien. Zaza konnte ebenfalls kaum aufstehen. Ich bot ihr meine Hand an und half ihr. Zaza ließ meine Hand nicht mehr los, und so kletterten wir Hand in Hand von der Bahn runter.
„Gehen wir um die Bahn rum, vielleicht ist auf der andern Seite alles wie gehabt“, schlug Zaza vor. Sie klang nicht sehr überzeugt.
Unter normalen Umständen hätte ich mich riesig gefreut, dass sie meine Hand fest in ihrer Hand hielt. Hier war aber alles so unheimlich, dass Freude gar nicht aufkommen konnte. Ich war komplett verstört.
Auf einmal nahm ihre Stimme einen freudigen Ton an. „Sieh mal, dort drüben!“
In etwa hundert Metern Entfernung erblickte ich Brauni und Camel durch die Wiese schlendern. Wir riefen sofort aus vollem Hals: „Brauniiii, Caamel!“
Sie wirbelten herum und kamen mit einem lauten „Hallooo!“ auf uns zugerannt. Wir umarmten uns stürmisch, Zaza und Camel einander sogar unter Tränen.
Zaza wimmerte schließlich: „Wenn wir uns gefunden haben, dann kann es nicht so schlimm sein.“
Ich war da skeptischer. „Hat jemand ne Ahnung, was das hier alles soll?“ Ich konnte das Zittern in meiner Stimme kaum verbergen.
Brauni sah alle bedeutungsvoll an, als wüsste er etwas. „Erinnert ihr euch, ich hatte doch vorgeschlagen, auf den Rummel zu gehen, weil ich mich fast ein bisschen in den „Luna Park“ zurücksehnte.“
„Genau“, bemerkte Camel eifrig. „Du hast wortwörtlich gesagt: Da war’s ja noch besser im „Luna Park“, als du an deine eklige Pflegefamilie gedacht hast.“
Ich runzelte die Stirn. „Du meinst, weil Brauni in einer Laune in den „Luna Park“ zurückwollte, sind wir jetzt alle wieder dort?“
Camel starrte Löcher in den Boden, wirkte, als denke er besonders angestrengt nach. „Sind wir nicht alle mit unserer Situation zu Hause unzufrieden gewesen, und haben wir nicht alle insgeheim gedacht, dass es da selbst im „Luna Park“ noch besser war?“
„Du meinst, trotz der gruseligen Dinge, die sich dort abgespielt haben?“, gab ich zu bedenken.
Camel holte tief Luft. „Die haben wir vielleicht für Momente ausgeblendet. Im „Luna Park“ war was los. Wir waren dort die Hauptpersonen. Auf uns kam es an. Unser Handeln war gefragt. Zu Hause und in der Schule haben sie uns gezeigt, dass wir Nichtse sind, Luft, nur lästig.“
Alle wurden ganz still. Wir setzten uns ins Gras, und jeder versank in Gedanken.
Camel hatte recht, überlegte ich zögerlich. Irgendwie hatte jeder von uns sich wenigstens für einen Moment gewünscht, wieder im „Luna Park“ zu sein. Und wenn es nur aus Protest gegen unsere Eltern und die Schule gewesen war. „Aber hier sieht es nicht aus wie im „Luna Park““, platzte ich in die Stille hinein.
Alle schauten sich noch einmal um, schauten auf die verlassene Geisterbahn und in die leeren Weiten der Landschaft. Ja, die Landschaft war leer, nur Wiesen, Berge, ein See, keine Menschen, keine Tiere, keine Häuser. Kein Vergnügungspark wie der „Luna Park“. Es hatte etwas Beklemmendes.
„Was machen wir jetzt?“ Zaza hatte nur noch ein Stimmchen.
Brauni schien zuversichtlicher: „Wir wollten grade über die Wiesen zum See. Irgendwo wird schon jemand sein, der uns weiterhelfen kann.“
Ich schüttelte den Kopf. „Guck doch hin! Ringsherum alles leer; keine Menschen, keine Autos, keine Häuser. Bis zu den Bergen dort hinten sind es mindestens fünfzig Kilometer. Es macht keinen Sinn, einfach irgendwohin zu latschen.“
Brauni blickte verwirrt in die Ferne.
Zaza wirkte auf einmal eine Spur optimistischer. „Wir sollten noch mal in die Geisterbahn. Über die Geisterbahn sind wir hierhergeraten. Vielleicht kommen wir über die Geisterbahn auch wieder hier raus?“
„Hm“, brummte Camel. „Brauni und ich sind nicht mit der Bahn gefahren, und wir sind genauso an dem öden Ort hier gelandet.“
„Auch wieder wahr“, pflichtete ich bei. „Trotzdem ist es vielleicht nicht die schlechteste Idee, noch mal dort reinzugehen. Die Geisterbahn ist vielleicht so was wie ne Raum-/Zeitmaschine, die uns an alle möglichen Orte bringen kann.“
„Am liebsten wär mir ein Ort, an dem es was zu essen gibt. Ich krieg langsam nen Riesenhunger“, maulte Brauni.
*
„Nehmen wir nen Wagen?“
„Die fahren nicht mehr.“
„Im Tickethäuschen ist doch ein Schaltbrett. Da kann man vielleicht die Bahn wieder in Betrieb setzen“, schlug Brauni vor.
Neben der Alarmleuchte, die immer noch rot blinkte, gab es mindestens zwanzig Knöpfe. Nirgendwo war eine Beschriftung.
„Wir können einen nach dem andern ausprobieren und sehen, was passiert“, schlug Zaza vor.
„Und wenn was Schlimmes passiert?“, gab Camel zu bedenken.
„Schlimmer kann es nicht werden“, maulte Brauni. „In einer riesigen Einöde zu sein, und nirgends was zu essen. Wenn wir noch länger hierbleiben, verhungern wir … oder müssen Gras fressen.“
Da war was dran. Also betrat ich das Tickethäuschen und drückte ängstlich auf den ersten Knopf links oben auf dem Schaltbrett. Wir warteten gespannt, sahen uns vorsichtig um. Nichts geschah. Ich drückte den zweiten. Nichts rührte sich. Ich drückte jetzt immer mutiger einen nach dem andern, war schon nicht mehr vorsichtig.
Beim letzten Knopf, den ich drückte, ertönte ein lautes, quietschendes Geräusch. Wir fuhren alle zusammen. Das Froschmaul war aufgesprungen. Camel, der zwischen zwei Wagen auf der Bahn stand, konnte gerade noch von den Schienen springen. Die Wagen setzten sich langsam ruckend in Bewegung. Einer nach dem andern verschwand durch das Froschmaul.
Endlich schrie Brauni: „Los, es reicht noch auf den Letzten!“ Und Sekunden später saßen wir zu viert, dicht gedrängt, im letzten Wagen und fuhren durch das Froschmaul ins Innere.
Es war schwer zu sagen, wer von uns am meisten Angst hatte. Ich war zwischen Brauni und Zaza eingeklemmt; Brauni fühlte sich schweißnass an, und Zazas Zittern übertrug sich von ihrem Arm auf meinen Körper. Camel klapperte rechts außen so laut mit den Zähnen, dass es nicht zu überhören war.
In der Bahn war es nicht mehr ganz dunkel wie bei unserer ersten Fahrt. Rechts und links gingen Spotlights an und aus und beleuchteten in Giftgrün von der Decke baumelnde Skelette. Wir schrien wie verrückt. Mit einem Rucken blieb unser Wagen plötzlich stehen. Vor uns hebelte sich ein blauer Elefant aus dem Boden und trompetete uns laut an. Er sah wie eine Walt-Disney-Figur aus. Dann wischten uns wieder lange Fransen übers Gesicht. Zwerge, Kobolde, Echsen, Kröten, Schlangen tauchten in giftrotem Flashlight links und rechts neben uns auf. Sie waren lange genug beleuchtet, sodass man sehen konnte, sie waren aus Plastik. Der Wagen wurde langsamer, und ein Krokodil lief in einem moosgrünen Licht gemächlich über die Schienen, drehte seinen Kopf zu uns hin und zeigte sein Plastikgebiss. Es dauerte eine Weile, bis wir verstanden, dass hier drinnen alles harmlos war, aus Plastik und Pappe, dass sich eigentlich nichts von einer normalen Rummelgeisterbahn unterschied. Es ging noch um ein paar Kurven und Ecken. Blitzlichter schienen uns grell ins Gesicht, das Gebrüll eines Löwen kam von links aus dem Dunkeln, von oben fiel ein zähnebleckender Stoffaffe in unseren Wagen und wurde gleich wieder an einer Schnur hochgezogen. Dann lag vor uns schon die Ausgangsklapptür. Der helle Spalt in der Mitte weitete sich. Es wurde hell. Wir waren draußen!
Ich blinzelte benommen ins Tageslicht. Zuerst sah ich die Kinder, die am Tickethäuschen anstanden. Dann die Buden und Zelte und Fahrgeschäfte gegenüber und das dichte Menschengewimmel auf der Straße.
Zaza, Camel und Brauni starrten mit offenen Mündern.
Ein stämmiger Junge, der den Mädchen und Jungs weiter vorn in die Wagen half, rief uns forsch zu: „Aussteigen, hier wird nicht noch mal gefahren, ohne zu bezahlen!“
Der Junge fasste uns grob an den Armen und zog uns aus dem Wagen. Sofort sprangen drei Kinder in unseren Wagen und verschwanden gleich durch das Froschmaul.
Wir kletterten von der Bahn herunter auf die Straße und sahen uns baff nach allen Richtungen um. Camel weinte schon vor Erleichterung: „Wir sind wieder zurück in der Zivilisation!“
Brauni rief mit schweißglänzendem Gesicht: „Ich kauf mir gleich ne Bratwurst und ein halbes Hähnchen in der Fressbude dort drüben. Ich hab einen Riesenstresshunger!“
„Wir müssen uns zuerst mal beruhigen“, sagte ich.
Camel atmete so unregelmäßig, als sei er eine lange Strecke gerannt: „Vielleicht zuerst was trinken“, keuchte er.
Wir folgten Brauni zu der Wurst- und Hähnchenbude und kauften uns dort ein paar Dosen Bier und Essbares. Obwohl zumindest Zaza und ich nicht aussahen, als seien wir schon sechzehn, gaben sie uns das Bier anstandslos.
*
Es dunkelte bereits. Die Luft war mild. Wir setzten uns im Gewühl der Menge auf eine Bank und schlürften das Bier, während Brauni so gierig in goldbraun gebackene Hühnerschenkel biss, dass ihm das Fett zu den Mundwinkeln herausspritzte. Wir aßen und tranken und versuchten, uns zu entspannen, ohne zu quatschen.
Brauni war völlig ins Essen vertieft. Camel guckte mit glasigen Blicken in die Menge und hatte ein seliges Lächeln auf dem Gesicht. Zaza trank mit geschlossenen Augen und seufzte leise. Ich saß ganz nahe neben Zaza und musterte den zarten Haarflaum auf ihrem Gesicht, während sie die Augen geschlossen hielt.
„Wie spät ist es eigentlich?“, fragte Brauni plötzlich mit vollem Mund.
Zaza riss die Augen auf.
Ich wandte mich etwas verlegen von Zaza ab und wollte auf meine Uhr sehen. „Es wird langsam dunkel.“ Meine Uhr war weg. Meine teure Taucheruhr. Meine Eltern, hatte ich den Verdacht, kauften mir solche Luxusgeschenke, weil sie dann das Gefühl hatten, sie seien dafür entschuldigt, dass sie sich so wenig mit mir beschäftigten. „Ich muss meine Uhr verloren haben“, sagte ich ohne große Sorge. Der Verlust war mir jetzt egal.
„Verdammt, meine Uhr ist auch weg!“, fluchte Camel.
„Ich hab auch keine Uhr mehr“, stellte Zaza verwundert fest.
Brauni schluckte den letzten Bissen und lachte laut auf. „Die haben sie euch sicher in der Geisterbahn geklaut. Die war ein wahrer Zauberladen. Gut, dass ich keine Uhr hab.“
„Es ist bestimmt bald acht. Wir müssen schleunigst nach Hause! Lasst uns jemanden nach der Zeit fragen“, schlug Camel vor. „Wenn es später als neun wird, dreht meine Mutter durch und macht ne Riesenszene. Sie kommt dann vom Hundertsten zum Tausendsten, wie viel sie für mich getan hat, wie sehr sie darunter leiden musste, mich allein aufzuziehen, wie schlimm es ist, allein alle Verantwortung tragen zu müssen, was für ein verantwortungsloser Nichtsnutz mein Vater ist, einen Sohn in die Welt zu setzen und sich dann davonzumachen und, und, und. Ich wär besser gar nicht auf die Welt gekommen.“
Zaza drückte Camel zärtlich die Hand: „Beruhig dich. Es ist nicht deine Schuld, dass sie alleine ist. Du hast damit nichts zu tun. Ich frag jetzt schnell jemanden nach der Zeit.“ Zaza sprang auf und verschwand in der Menge.
Erst eine ganze Weile später kam sie wieder zu unserer Bank zurück. Ich hatte schon Angst, es sei etwas passiert.
„Warum hast du solange gebraucht?“, fragte ich vorwurfsvoll.
„Alle, die ich gefragt habe, hatten keine Uhr dabei. Dann fiel mir auf, dass überall nur Jungs und Mädchen sind und kein einziger Erwachsener. Ein Junge wollte mir weismachen, dass hier Uhren unnütz sind, weil die Zeit Kapriolen schlägt. Er hat behauptet, die Zeit kann hier beliebig gedehnt oder verkürzt werden.“
„Nur Jungs und Mädchen … Die Zeit läuft hier anders …“ Ich merkte nicht einmal, dass ich laut vor mich hinsprach, während ich dachte, dass mir das verflucht bekannt vorkam. „So war es doch auch im „Luna Park“!“, rief ich laut aus.
Wir sahen alle augenblicklich in die Menge. Tatsächlich, die Straße wimmelte von Mädchen und Jungs. Und nirgendwo war ein Erwachsener. Nur beim Rummelpersonal, also bei den Leuten, die die Rummelattraktionen bedienten, gab es ganz vereinzelt Erwachsene.
„Dann sind wir ga-gar nicht auf dem Rummel in B-Berlin, meint ihr?“, stotterte Camel.
„Unsinn“, prustete Brauni und verschluckte sich am Bier. „Dass hier nur Jungs und Mädchen sind, heißt noch gar nichts. Eltern gehen heutzutage nicht mehr auf Rummelplätze mit. Das ist denen zu viel Aufwand. Die sind doch alle nur noch überlastet. Kommt, wir gehn nach Hause!“ Brauni stand auf, und wir folgten ihm einfach.
*
Über uns leuchteten die ersten Sterne am dunkelblauen Himmel, und eine bleiche, scharf geschnittene Mondsichel. Wir gingen und gingen. Der Weg kam mir ungeheuer lang vor. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass es auf dem Berliner Rummelplatz so große Entfernungen gegeben hatte.
Auch Camel wurde zunehmend misstrauisch. „Wir müssten schon längst draußen sein.“
Zaza zog mich am Arm: „Wartet!“
Wir hielten in der Menge der Kinder und Jugendlichen an.
„Wie lange wollen wir noch weitergehen? Wir sind nicht mehr in Berlin!“
„Nur noch die hundert Meter bis dort vorn, dort ist der Ausgang, Richtung Einkaufszentrum „Der Clou“.“ Brauni blieb stur.
Wir waren alle erschöpft, zu müde, uns weiter Gedanken zu machen. Und vielleicht setzten wir nur deshalb unseren Weg fort. Erst als der Ausgang ganz eindeutig immer weiter in die Ferne rückte, je mehr wir auf ihn zugingen, musste auch Brauni langsam zugeben, dass hier etwas nicht stimmte, dass hier gar nichts mehr stimmte.
„Schaut mal nach dort drüben!“, forderte Zaza uns auf einmal laut auf.
Wir blickten alle in die Straße, die nach links abzweigte.
„Schaut auf das Schild!“, forderte Zaza uns nochmals auf.
An der Straßenecke stand ein Wegweiser. In Leuchtrosa stand darauf: „Luna Park Süd“.
Zurück im Luna Park
Wir sahen einander vielsagend an und dann betreten die Straße entlang. Jetzt war es endgültig klar. Wir waren nicht mehr in Berlin.
Die Straße war viele Kilometer lang. Sie lief leicht abwärts. Anfangs säumten sie noch Buden und Karussells. Dann schloss sich ein weitläufiges Häuserviertel an, das mich an eine brasilianische Favela erinnerte – solch eine Favela hatte ich auf einer der teuren Fernreisen gesehen, auf die mich meine Eltern mitgenommen hatten, wahrscheinlich um ihr Gewissen zu beruhigen.
Brauni überblickte die Ebene, die sich vor uns auftat. „Was sind denn das für Slums?“ Brauni kannte Slums sicher aus dem Fernsehen.
Zaza seufzte nur erschöpft. Ich legte ihr meinen Arm um die Schultern, ohne dass sie protestierte.
Es waren eher Hütten als Häuser, teils mit Wellblech bedeckt, dicht an dicht gebaut. Sie waren eingebettet in ein Labyrinth sich eng windender Gassen. Die Hütten sahen aus wie zufällig zusammengewürfelt. Und weiter hinten ragte ein Hochhaus auf, das düster aussah, sogar baufällig. Soweit das Auge reichte, diese ärmlichen Hütten, und dann endete die Sicht an einem hohen Zaun, einem immens hohen, undurchsichtigen Zaun aus einem Material wie Eisengeflecht.
Wir standen da und starrten, konnten uns auf das, was wir sahen, keinen Reim machen.
„Wenn das der „Luna Park“ sein soll“, überlegte Zaza laut, „dann hat er sich aber ganz schön verändert.“
„Allerdings“, pflichtete ich hilflos bei.
„Die Slums da unten, das ist „Luna Park Süd“. Was ist dann „Luna Park Nord“?“, fragte Brauni. „Süd und Nord gab es früher nicht im „Luna Park“. Es gab dort auch keine Wohnhäuser. Nur den Rummelplatz mit seinen Anlagen und das Schloss des Königs des „Luna Parks“.“
Bei den Worten „König des Luna Parks“ zuckte Zaza zusammen und lief rot an. Das ärgerte mich. Man musste ihn nur nennen, und schon ging es wieder los … Ich trat ein paar Schritte von Zaza weg und war bitter enttäuscht. „Was sollen wir jetzt tun?“, fragte ich, nur um etwas zu sagen.
Brauni keuchte: „Ich bin fix und fertig, ich muss erst mal was essen.“
Wir waren ziemlich weit gelaufen und waren mittlerweile alle hungrig. Wir mussten uns auch stärken, um überhaupt einen klaren Gedanken fassen zu können.
„In welche Richtung sollen wir?“ Ich war so müde, dass ich alles den andern überließ.
Brauni zog Luft durch die Nase ein und behauptete, ein Duft nach asiatischem Essen läge Richtung „Luna Park Süd“ in der Luft. Wir folgten wieder Brauni, und nach ungefähr fünfzig Metern bogen wir in eine enge Gasse ein, in der es nur so von asiatischen Garküchen wimmelte. Es roch nach heißem Fett. Zwischen den Kochstellen standen Bänke und Tische aus rohem Holz. Alles hier war schmuddelig.
Wir nahmen Platz und ließen uns von einem Chinesen mit einer fettigen Schürze bedienen. Es gab nur ein Gericht. Als er es nach fünf Minuten brachte, war es gebratener Reis mit etwas Ei, Erbsen und einem winzigen Stückchen Huhn. Er stellte einen Wasserkrug so hart auf den Tisch, dass es spritzte, und ein paar Plastikbecher. Andere Getränke gab es hier nicht. Wir waren im Moment nicht sehr wählerisch und aßen den trockenen Reis. Es schmeckte fad, aber füllte wenigstens den Magen.
„Früher hat man im „Luna Park“ besser gegessen“, bemerkte Camel leise.
Kaum hatten wir fertig gegessen, kam der Chinese mit einem schmierigen Zettel an unseren Tisch, der Rechnung. „Macht 33 Euro.“ Während er am Tisch auf das Geld wartete, wischte er seine Hände an der fettglänzenden Schürze ab.
Wir sahen uns an. Im „Luna Park“ war alles umsonst gewesen. Man hatte umsonst leckere Dinge essen, umsonst mit sämtlichen Bahnen und Karussells fahren können. Nichts hatte etwas gekostet. Das Prinzip des „Luna Parks“ war schlemmen und sich amüsieren gewesen, ohne je zu bezahlen, bis in alle Ewigkeit. Auf den ersten Blick ein Paradies …
Brauni zog unwillig einen verknitterten Fünfeuroschein aus seiner Hosentasche. Zaza und Camel legten zehn Euro zusammen. Ich zahlte den Rest. Ich hatte danach noch zwanzig Euro übrig. Zaza, Brauni und Camel hatten bereits alles ausgegeben. Der Chinese scharrte das Geld auf dem Tisch zusammen, steckte es in seine Schürzentasche und wollte sich schon wieder zu seinem Herd umdrehen, als Brauni laut fragte: „Im „Luna Park“ ist doch alles umsonst, warum haben Sie Geld von uns verlangt?“
Der Chinese zog die Brauen hoch. „Hier ist nichts umsonst. Wie kommst du auf die Idee? Alles hat hier seinen Preis. Vielleicht zahlen wir noch bald fürs Atmen.“
„Das sind schlechte Nachrichten“, analysierte Brauni und wischte sich mit einer zerknitterten Papierserviette über den Mund. „Wir sind im „Luna Park“. Der ist aber ganz anders. Es ist anzunehmen, dass wir auch aus diesem „Luna Park“ nicht einfach wieder rausspazieren können in unsere Welt. Und wir sind gleich zu Anfang in einer misslichen Lage. Wie sollen wir hier überleben mit Dugos lumpigen 20 Euro?“
Zaza war schon den Tränen nahe. Ich spürte es. Ich musste sie unbedingt beruhigen. „Jetzt haben wir erst mal gegessen und fühlen uns besser. Wenn es uns letztes Mal gelang, aus dem Park wieder ungeschoren rauszukommen, dann finden wir auch diesmal einen Ausweg …“
Brauni unterbrach mich: „Nicht so schnell. Überlegt mal alle ganz scharf. Warum sind wir wieder hier? Irgendwie wollten wir alle nochmals in den „Luna Park“ … Es kann also nicht darum gehen, hier gleich wieder rauszukommen. Wir sind jetzt hier und müssen erst mal sehen, was uns diesmal hier erwartet.“
Camel nahm Braunis Gedanken gleich auf: „Brauni hat recht. Auf uns warten hier irgendwelche Aufgaben, irgendein Test. Erst wenn wir den Test bestanden haben, kommen wir wahrscheinlich mehr oder weniger automatisch wieder in unsere Welt zurück.“
„Wie letztes Mal“, ergänzte Zaza, deren Miene sich bereits wieder beträchtlich aufgehellt hatte. „Und was machen wir jetzt?“
Alle schwiegen. Bis Brauni die Initiative ergriff und aufstand: „Wir sehen uns zunächst mal den Park näher an.“
*
Wir folgten Brauni nach draußen auf die Straße, die nach „Luna Park Süd“ führte. Es war inzwischen dunkel geworden, aber zum Glück nicht kühl. Rostige Laternen auf alten Holzmasten beleuchteten die Straße einige Hundert Meter, dann wurde es immer düsterer. Die Slums bildeten eine schwarze Masse. In diese finstere Gegend wollten wir nicht gehen. Noch bevor wir uns umwandten, um in die entgegengesetzte Richtung zu gehen, hörten wir, wie hinter uns jemand laut fluchte.
Wir drehten uns erschrocken und sahen, wie der Chinese, der uns bedient hatte, einer völlig zerlumpten Gestalt einen Fußtritt gab! Die Gestalt stolperte auf die Straße und landete auf den Knien im Straßenstaub. Mühsam richtete sie sich wieder auf und hinkte auf uns zu. Es war ein höchstens vierzehnjähriger Junge. Wir konnten kaum sein Gesicht erkennen unter dem schwarzen Schmutz. Der Schmutz überzog es wie eine Maske. Die Haare waren staubgrau verfilzt. Alles an dem Jungen starrte vor Dreck. Seine ausgefransten Jeans und sein T-Shirt hatten riesige Löcher. „Gebt ihr mir nen Fünfer?“, bettelte er uns an. Er war auch ausgesprochen mager, und seine Augen glänzten fiebrig. „Ich hab seit zwei Tagen nichts gegessen.“
„Dugo, du hast doch noch Geld“, platzte Zaza heraus.
Ich ärgerte mich, dass sie mich auffordern musste. Ich hätte doch von mir aus etwas gegeben. Mit saurem Aufstoßen fingerte ich in meiner Hosentasche herum, fischte schließlich ein Eurostück heraus und gab es dem Jungen in seine schmutzige Hand. Er lächelte mich an und bedankte sich immer wieder. Es war mir irgendwie sehr peinlich. Warum eigentlich? Ich blickte ihm betreten nach, wie er nach „Luna Park Süd“ wankte und weiter unten wieder zwei Jungs ansprach, die, wie wir, „normal“ gekleidet waren.
„Hoffentlich kriegt er noch mehr Geld zusammen.“ Zaza sah mich vorwurfsvoll an. „Sonst verhungert er noch.“
Ich fühlte es, ich wurde dunkelrot, und wusste nicht, ob vor Ärger, oder weil ich mich schämte, so knauserig gewesen zu sein.
Ganz unerwartet kam mir Brauni zur Hilfe. „Wir haben jetzt zu viert noch 19 Euro, Zaza. Wir sind bald auch nicht besser dran.“
Zaza machte nur: „Hm“, und blickte zu Boden.
„Wir können uns jetzt nicht länger mit Kinkerlitzchen aufhalten. Wir müssen den Park auskundschaften, rausfinden, was wir hier sollen, sonst ergeht’s uns noch so wie dieser armen bettelnden Sau!“ Camel ging energisch in die Richtung, aus der wir gekommen waren, und wir folgten.
*
Gefällt mir Wird geladen …









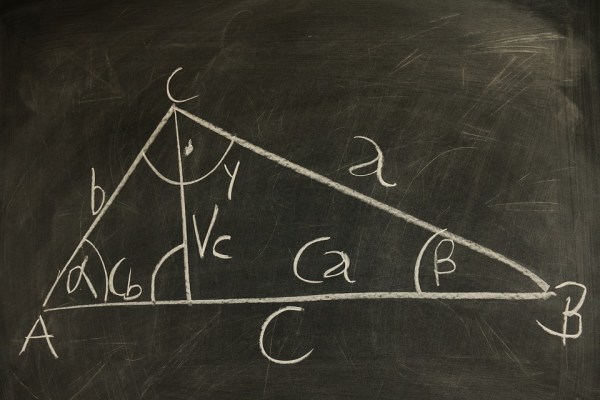











 „Was haben Erdoğan, Maduro und Hitler gemein?“ Ich verschlucke mich am Mogenkaffee und kann nicht gleich antworten. Garfield spricht weiter: „Erdoğan hat 1981 einen Abschluss in Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaften an der Marmara-Universität gemacht. Die gab’s zu der Zeit aber noch gar nicht. Die wurde unter dem Namen erst ein Jahr später gegründet. Der Dekan und der Rektor, die das Diplom unterschrieben haben, waren erst ab 1982 im Amt. Und auf der Internetseite der Nahverkehrsgesellschaft der Stadt Istanbul liest du, dass Erdoğan bis 1981 bei der Nahverkehrsgesellschaft vollzeitbeschäftigt war.“ „Ich hab’s. Genau wie Maduro! Maduro war auch Busfahrer …“ „Nahe dran, Olivia. Maduro hat nach seinem Schulabschluss nicht studiert, sondern begann bei den U-Bahnen der Metro Caracas zu arbeiten.“ „Also quasi zwei Busführer … Äh, aber Hitler hat doch nicht im öffentlichen Verkehr gearbeitet …“ „Darum geht’s auch nicht. Mann, Olivia!“ „Was haben die drei also dann gemein?“ „Alle drei haben gemein, dass sie für den Regierungsjob total lausig qualifiziert waren. Der Führer war noch lausiger qualifiziert. 1907 bewarb Hitler sich erfolglos an der Wiener Kunstakademie. Ab 1910 hat er Geld mit dem Nachmalen von Wiener Postkarten verdient.“ „Willst du vielleicht am Ende sagen: Diktatoren werden typischerweise solche, die für Staatsämter alles andere als die geeignete Ausbildung bzw. den geeigneten Werdegang haben?“ „Bingo. Nur: nicht jeder Postkartenmaler wird Diktator. Es fehlt noch was.“ „So? Was denn?“ „Ein übersteigertes Selbstbewusstsein. Das gibt’s übrigens häufig bei Minderwertigkeitskomplexen.“ „Ah!“ „Du traust dir alles zu, kommst mit Chuzpe in ein hohes Staatsamt, bist aber miserabel ausgebildet, völlig ungeeignet, und stehst bald vor einem Berg von Problemen, die du, da du nicht durchblickst und dennoch handelst, auch selbst verursachst. Und was tust du dann?“ „Ja, was?“ „Du greifst zu dem Mittel der Lösung von Problemen, das dir am einfachsten erscheint. Zu Gewalt.“
„Was haben Erdoğan, Maduro und Hitler gemein?“ Ich verschlucke mich am Mogenkaffee und kann nicht gleich antworten. Garfield spricht weiter: „Erdoğan hat 1981 einen Abschluss in Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaften an der Marmara-Universität gemacht. Die gab’s zu der Zeit aber noch gar nicht. Die wurde unter dem Namen erst ein Jahr später gegründet. Der Dekan und der Rektor, die das Diplom unterschrieben haben, waren erst ab 1982 im Amt. Und auf der Internetseite der Nahverkehrsgesellschaft der Stadt Istanbul liest du, dass Erdoğan bis 1981 bei der Nahverkehrsgesellschaft vollzeitbeschäftigt war.“ „Ich hab’s. Genau wie Maduro! Maduro war auch Busfahrer …“ „Nahe dran, Olivia. Maduro hat nach seinem Schulabschluss nicht studiert, sondern begann bei den U-Bahnen der Metro Caracas zu arbeiten.“ „Also quasi zwei Busführer … Äh, aber Hitler hat doch nicht im öffentlichen Verkehr gearbeitet …“ „Darum geht’s auch nicht. Mann, Olivia!“ „Was haben die drei also dann gemein?“ „Alle drei haben gemein, dass sie für den Regierungsjob total lausig qualifiziert waren. Der Führer war noch lausiger qualifiziert. 1907 bewarb Hitler sich erfolglos an der Wiener Kunstakademie. Ab 1910 hat er Geld mit dem Nachmalen von Wiener Postkarten verdient.“ „Willst du vielleicht am Ende sagen: Diktatoren werden typischerweise solche, die für Staatsämter alles andere als die geeignete Ausbildung bzw. den geeigneten Werdegang haben?“ „Bingo. Nur: nicht jeder Postkartenmaler wird Diktator. Es fehlt noch was.“ „So? Was denn?“ „Ein übersteigertes Selbstbewusstsein. Das gibt’s übrigens häufig bei Minderwertigkeitskomplexen.“ „Ah!“ „Du traust dir alles zu, kommst mit Chuzpe in ein hohes Staatsamt, bist aber miserabel ausgebildet, völlig ungeeignet, und stehst bald vor einem Berg von Problemen, die du, da du nicht durchblickst und dennoch handelst, auch selbst verursachst. Und was tust du dann?“ „Ja, was?“ „Du greifst zu dem Mittel der Lösung von Problemen, das dir am einfachsten erscheint. Zu Gewalt.“ 





 Garfield sieht nichtmal hinter der Zeitung hervor, als ich mich an den Kaffeetisch setze. „Europa wird immer ärmer,“ grummelt er. „Der Binnenkonsum ist in den letzten 20 Jahren zusammengebrochen.“ „Was meinst du damit?“ „Im Zuge der Globalisierung sind die Löhne und Gehälter und die Renten und Pensionen gedrückt worden. Sogar die Bundesrepublik ist ein Niedriglohnland geworden. Und jetzt können wir unsre eigenen Produkte nicht mehr kaufen.“ „Du meinst wohl, da die EZB nicht mehr viel wirksamen Handlungsspielraum hat, es sei denn, gewisse gesetzliche Rahmenbedingungen, wie etwa der Maastrichtvertrag, werden verändert, soll die Politik Geld mit dem Helikopter abwerfen?“ „Schnurr. Löhne, Gehälter, Renten …, alles muss rauf.“ „Und wie willst du dann noch in einer globalen Wirtschaft konkurrenzfähig sein?“ „Du machst es mit Steuersenkungen. Nimm die Schweiz, die ist konkurrenzfähig, und im Land selbst sind die Löhne obszön hoch, bei akzeptablen Steuern. Die Kerle sind reich geblieben in einer ringsum verarmenden Welt. Es kann klappen.“ „Hm, Garfield. Und was wären dann akzeptable Steuern für dich persönlich?“ „25 % vom Einkommen würde ich akzeptabel finden und auch zahlen. Da liegt die Schmerzgrenze. Und ab da beginnt für mich die Steuerflucht.“ „Zum Glück musst du als Kater keine Steuern zahlen.“ „Aber du müsstest für mich Steuern zahlen.“ „Wi-wieso? Du bist mir doch nur zugelaufen. Ich wollte dich gar nicht! Ich bin damit, meiner Meinung nach, gar kein Katzenbesitzer …“ …
Garfield sieht nichtmal hinter der Zeitung hervor, als ich mich an den Kaffeetisch setze. „Europa wird immer ärmer,“ grummelt er. „Der Binnenkonsum ist in den letzten 20 Jahren zusammengebrochen.“ „Was meinst du damit?“ „Im Zuge der Globalisierung sind die Löhne und Gehälter und die Renten und Pensionen gedrückt worden. Sogar die Bundesrepublik ist ein Niedriglohnland geworden. Und jetzt können wir unsre eigenen Produkte nicht mehr kaufen.“ „Du meinst wohl, da die EZB nicht mehr viel wirksamen Handlungsspielraum hat, es sei denn, gewisse gesetzliche Rahmenbedingungen, wie etwa der Maastrichtvertrag, werden verändert, soll die Politik Geld mit dem Helikopter abwerfen?“ „Schnurr. Löhne, Gehälter, Renten …, alles muss rauf.“ „Und wie willst du dann noch in einer globalen Wirtschaft konkurrenzfähig sein?“ „Du machst es mit Steuersenkungen. Nimm die Schweiz, die ist konkurrenzfähig, und im Land selbst sind die Löhne obszön hoch, bei akzeptablen Steuern. Die Kerle sind reich geblieben in einer ringsum verarmenden Welt. Es kann klappen.“ „Hm, Garfield. Und was wären dann akzeptable Steuern für dich persönlich?“ „25 % vom Einkommen würde ich akzeptabel finden und auch zahlen. Da liegt die Schmerzgrenze. Und ab da beginnt für mich die Steuerflucht.“ „Zum Glück musst du als Kater keine Steuern zahlen.“ „Aber du müsstest für mich Steuern zahlen.“ „Wi-wieso? Du bist mir doch nur zugelaufen. Ich wollte dich gar nicht! Ich bin damit, meiner Meinung nach, gar kein Katzenbesitzer …“ …